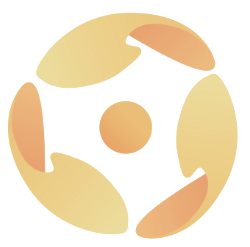Take responsibility and pursue clear goals
Self-awareness and optimism
Discover the space between stimulus and response. See challenges as an opportunity to strengthen the motivation and performance of your teams.
Predictability and performance
Lead your teams with clear principles and predictability. Achieve business goals through structure and effectiveness.
Gratitude and trust
Know your professional purpose and find your path. Develop your leaders and top performers with confidence and trust.
Become a True Leader and an Inspiration for Your Team
How can you shape your teams' collaboration with empathy and presence, well-founded decisions and sensitivity? Let's find your answers together, because I understand your challenges as a leader in the chemical industry with a scientific and technical background.

Find your balance between performance and life
Some issues cannot be solved with numbers, data, and facts alone. Leading technical teams and scientists also requires principles, predictability, and inspiration. The human and emotional dimension of a decision and its personal significance for you must fit. I help you gain clarity when you're looking for a sparring partner for difficult leadership tasks and challenges. You want to take your next development step – but where to? Let's talk!
Your Coach at Turning Points
I support you in critical career decisions: From entering your first leadership role to taking on greater responsibility to professional reorientation. I understand the specific challenges of your industry.
Find Solutions in Complex Situations
Loyalty conflicts, political navigation, positioning in newly created functions – I help you find your way even in demanding situations while remaining authentic.
From Decision to Implementation
Together we develop your goals and concrete steps. Whether strategic positioning, application support, or sustainable behavioral change – you receive the tools for measurable success.
Coaching or Consulting
According to your preference, I offer pure coaching to enable your solution finding, or concrete mentoring. Your needs determine the form of our collaboration – not the other way around.
Balance Between Performance and Life
Successful leadership doesn't mean sacrificing yourself. I support you in increasing your effectiveness while maintaining or restoring your quality of life.
Industry-Specific Expertise
The chemical industry has its own requirements and dynamics. I know the special challenges of scientists and engineers navigating between technical topics and leadership.
My Values – Your Security
Confidentiality
Your concerns and our exchanges remain absolutely confidential, as this is the foundation of successful collaboration.
Results Orientation
I work goal-oriented and practice-focused. Each session moves you concretely forward – but the strongest change happens within you between meetings.
Independence
As an external partner, I am free from corporate interests and political entanglements. Your progress is my focus.
Creativity
I challenge you with unusual questions and approaches. Leave your comfort zone – this is the only way sustainable development occurs.
Individuality
There are no standard solutions. Each collaboration is tailored to your specific situation, your goals, and your rhythm.
Flexibility
Whether short-term success or lasting change – you decide which solution you seek.
Ready for the Next Step?

The complimentary initial consultation gives both of us the opportunity to get to know each other and clarify whether and how I can optimally support you.
Ihre Karrierelandkarte in drei Horizonten: Vom Labor zur Linien- und Standortverantwortung
Wer in Chemie und Verfahrenstechnik mehr will als „nur“ den nächsten Job, braucht einen belastbaren Plan: eine Landkarte, die vom Einstieg über die erste Teamverantwortung bis hin zur Betriebs- oder Standortleitung führt – auch im Schichtbetrieb, in komplexen Anlagen und internationalen Projekten. Die 3‑Horizonte‑Methodik verbindet schnelle Wirksamkeit mit nachhaltiger Entwicklung und ist praxiserprobt in der Industrie:
- Horizont 1 (12–18 Monate): Wirkung zeigen, Stärken schärfen, Grundlagen für Führung legen.
- Horizont 2 (2–3 Jahre): Ihren Kompetenz‑Stack systematisch ausbauen und Projekte mit Signalwirkung führen.
- Horizont 3 (5+ Jahre): Verantwortung skalieren – mit klugem Timing von Expat-/Standortwechseln und klarer Positionierung für Linien‑ oder Standortverantwortung.
Im Zentrum stehen drei Bausteine, die alle Zielgruppen gleichermaßen tragen – vom Studium bis zur Standortleitung:
- Stärkeninventur und Rollen‑These: Welche Aufgaben passen zu mir und wo entfalte ich Hebelwirkung?
- Kompetenz‑Stack für Wirkung: PSM/EHS, GMP/Qualität, Lean/OEE, CAPEX, datenbasierte Kommunikation, Führungspräsenz.
- Projektwahl mit Signalwirkung und eine Stakeholder‑/Sponsorenkarte, die Sie in der Organisation gezielt verankert.
Dazu kommen messbare Meilensteine (z. B. OEE↑, Ausbeute↑, TRIR↓), 90‑Tage‑Pläne, Lern‑Sprints und ein Evidenzlogbuch für Soft Skills. So zahlt jede Station konkret auf die nächste Führungsstufe ein – sichtbar, belegbar und anschlussfähig für Entscheider.
Horizont 1 (12–18 Monate): Stärken schärfen, sichtbare Wirkung erzeugen
Ziel: Sie bauen ein klares Profil auf, erzeugen messbare Ergebnisse in Ihrem Wirkbereich und lernen, diese datenbasiert und adressatengerecht zu kommunizieren.
1) Stärkeninventur und Rollen‑These
- Erheben Sie Ihre Energie‑ und Leistungsfelder: Labor/Analytik, Anlagenbetrieb, Qualitäts-/Regulatorik, Instandhaltung, Supply, EHS, Digital/Automatisierung.
- Formulieren Sie eine Rollen‑These: „Ich erziele überproportionale Wirkung, wenn ich …“ (z. B. „… kritische Qualitätsprozesse strukturiere und GMP‑Schwachstellen schließe“ oder „… OEE‑Bremsen im Schichtbetrieb identifiziere und mit der Linie löse“). Diese These prüft und schärft Ihre Projektwahl.
2) 90‑Tage‑Plan mit Quick Wins
- Ergebnisziele: 1–2 Kennzahlen identifizieren, die Ihre Rolle sichtbar verbessern (z. B. OEE +2–3 %, Ausbeute +0,5–1,0 %-Punkte, TRIR‑relevante Beinahe‑Unfälle −20 %).
- Arbeitspakete strukturieren (A3 oder DMAIC): Ist‑Analyse, Engpasshypothesen (FMEA/5‑Why), Maßnahmen, Wirkprüfung.
- Kommunikationsroutinen etablieren: wöchentlicher Stakeholder‑Ping, 14‑tägiger Kurzbericht mit Charts (Trend, Pareto, Kosten/Nutzen), Shopfloor‑Talks im Schichtwechsel.
3) Lern‑Sprints (alle 4–6 Wochen)
- Technik/Prozess: HAZOP/LOPA‑Grundlagen, Datenaufbereitung (Power BI/Python‑Basics), statistische Prozesskontrolle.
- Qualität/Regulatorik: GMP‑Deviation‑Handling, Change Control, Audit‑Readiness.
- Lean/Operational Excellence: SMED, Wertstrom, Standardarbeit im Schichtbetrieb.
- Transfer sichern: pro Sprint eine Pilot‑Anwendung im Tagesgeschäft.
4) Evidenzlogbuch für Soft Skills
- Struktur: Datum – Kontext – Verhalten – Wirkung – Feedback – Beleg (z. B. Folie, Mail, KPI‑Chart).
- Typische Einträge: „Konfliktgespräch zur Schichtübergabe moderiert; Eskalation vermieden; Vereinbarung zur Standardarbeit; OEE in den Folgeschichten stabilisiert.“
- Nutzen: Ihr Logbuch liefert Entscheider:innen den Beweis für Teamorientierung, Kommunikationsstärke und Präsenz – entscheidend für das „Ticket“ in die nächste Rolle.
5) Stakeholder‑Basics
- Karte der relevanten Akteure: Produktionsleitung, EHS/PSM, Qualität, Instandhaltung, Betriebsrat, Schichtführer:innen, Global Process Owner, ggf. Kunden/Auditor:innen.
- Sponsoren identifizieren: Wer profitiert direkt von Ihrem Zielbeitrag? Sichern Sie früh einen Sponsor auf Abteilungsleiterebene und einen operativen „Champion“ in der Schicht.
Horizont 2 (2–3 Jahre): Kompetenz‑Stack aufbauen und Projekte mit Signalwirkung führen
Ziel: Sie erweitern Ihren Hebel von der Fachrolle zur Führungswirkung über Prozesse, Teams und Budgets – in der Linie und in bereichsübergreifenden Initiativen.
1) Ihr Kompetenz‑Stack für Wirkung
- PSM/EHS: HAZOP/LOPA leiten, MOC konsequent umsetzen, Beinahe‑Ereignisse in lernende Routinen überführen; TRIR‑Reduktion mit Leading Indicators.
- GMP/Qualität: Deviation‑Trendanalysen, Root‑Cause‑Exzellenz (5‑Why/Is‑Is not), Audit‑Vorbereitung; Right‑First‑Time verbessern.
- Lean/OEE: Engpassmanagement, stabile Standardarbeit, Gemba‑Routinen; Shopfloor‑Boards mit klaren Soll‑/Ist‑Signalen.
- CAPEX: von Business Case bis FAT/SAT; Stakeholder‑Buy‑in, Stage‑Gate‑Reife, Lebenszykluskosten.
- Datenbasierte Kommunikation: A3‑Storylining, Management‑Summary auf 1 Seite, Dashboarding (z. B. Power BI), Entscheidungsfolien mit klarer Empfehlung.
- Führungspräsenz: kurze, klare Botschaften; Feedback in beide Richtungen; Entscheidungsfreude plus Nachsteuerung anhand von Fakten.
2) Projektwahl mit Signalwirkung
- Turnaround: kritischen Stillstand planen und sicher wieder hochfahren (EHS‑First, Qualität, OEE‑Ramp‑Up). Signal: „beherrscht Risiko, Timing und Führung unter Druck.“
- Scale‑up: Transfer Labor/Pilot in Produktion; CP/PPQ, Prozessfenster, Stabilitätskonzept. Signal: „baut Brücken zwischen Entwicklung und Werk.“
- Debottlenecking: Engpass identifizieren und nachhaltig auflösen; OEE und Ausbeute belegen. Signal: „liefert harte Ergebnisse im Kern der Wertschöpfung.“
- Digitalinitiative: Condition Monitoring, eBR/MES‑Nutzung, Alarmmanagement. Signal: „verknüpft Daten und Entscheidungen – pragmatisch, nicht akademisch.“
- Schichtstabilisierung: Personaleinsatz, Qualifikationsmatrix, Abweichungsroutinen; Abwesenheits‑ und Störungsrobustheit. Signal: „versteht Linie, Menschen, tägliche Realität.“
3) Stakeholder‑ und Sponsorenkarte verfeinern
- Map nach Einfluss/Interesse: Wer entscheidet, wer prägt Meinungen, wer blockiert?
- Allies systematisch pflegen: monatliche Kurz‑Syncs mit Sponsor; Shopfloor‑Shadowing mit Schichtführung; gemeinsame KPI‑Reviews mit Qualität/EHS.
- Governance sichtbar bedienen: Steering Committees, CAPEX‑Gates, Audit‑Follow‑ups – mit knappen, entscheidungsreifen Unterlagen.
4) Messbare Meilensteine definieren
- OEE +3–7 %, Ausbeute +1–2 %-Punkte, First‑Pass‑Yield +5–10 %, TRIR −20–40 %, Deviation‑Backlog −50 %, CAPEX on‑time/on‑budget ≥95 %.
- „Vorher/Nachher“ dokumentieren: Basislinie, Maßnahmen, Effekte, finanzielle Wirkung (z. B. €/t, €/Charge, Ausschusskosten).
- Lessons Learned sichern: Was skaliert? Was braucht Standard? Was bleibt bewusst individuell?
5) Führungsübergänge proben
- Teilprojektleitung, Schichtvertretung, Kaizen‑Leader‑Rolle übernehmen.
- Entscheidungs‑ und Eskalationsregeln klären; die Linie in kritischen Zeitfenstern stabil halten.
- Feedbackkultur trainieren: 1‑on‑1‑Routinen, klare Erwartungen, „Commitments sichtbar machen“ (Board, Ticket, Check‑Out).
Horizont 3 (5+ Jahre): Verantwortung skalieren – Expat, Standortwechsel, Linienführung
Ziel: Sie positionieren sich sichtbar für Linien‑, Betriebs‑ oder Standortverantwortung und treffen bewusste Weichenstellungen, die fachliche Breite, Geschäftsnähe und Teamführung verbinden.
1) Portfolio Ihrer Wirkung kuratieren
- Drei‑Seiten‑Dossier: „Probleme, die ich löse“ (EHS, Qualität, OEE, Kosten, Versorgungssicherheit), „Teams, die ich stark mache“ (Schicht, Instandhaltung, QS), „Geschäftsergebnisse, die ich sichere“ (Servicegrad, Marge, Cash).
- Evidenzsammlung: 5–7 Leuchtturmprojekte mit KPI‑Impact, Rolle, Stakeholder, gelerntem Führungsverhalten – prägnant, belegbar, anschlussfähig.
2) Expat‑ und Standortwechsel gezielt timen
- Expat‑Logik: Kurz vor oder nach größerer Verantwortung; ideal mit klaren Mandaten (Start‑Up, Brownfield, Turnaround, Qualitätsklemme).
- Standortwechsel nutzen, um den Kompetenz‑Stack zu komplettieren (z. B. von GMP‑Umfeld in Bulk‑Chemie/PSM oder umgekehrt).
- Sponsoring sichern: Vor dem Wechsel zwei Ebenen „über“ und „neben“ Ihnen verankern; Rückkehr‑Pfad mit Perspektive abstimmen.
3) Linienverantwortung skalieren
- Betrieb führen heißt Trade‑offs beherrschen: Sicherheit/Qualität/Kosten/Lieferfähigkeit in tägliche Entscheidungen übersetzen.
- Führungsrhythmus aufsetzen: Daily/Weekly/Monthly mit klaren Kennzahlen, Abweichungsmanagement, Eskalationspfaden.
- Talente entwickeln: Qualifikationsmatrizen, Nachfolgeplanung, Coaching am Shopfloor; starke Schichtführungsriege als Rückgrat.
- CAPEX‑Governance und Investitionsstory: Portfolio priorisieren, Risiken aktiv managen, Nutzen realisieren – transparent gegenüber Geschäftsführung und Audit.
4) Außenwirkung und Vertrauensbilanz
- Kommunizieren Sie als Owner: klare Botschaften, ruhige Präsenz in Krisen, Fakten vor Meinung.
- Netzwerke pflegen: Lieferanten, Behörden, Kunden; in Verbänden/Arbeitskreisen sichtbar werden (ohne Geheimhaltung zu verletzen).
- Kultur prägen: Null‑Unfall‑Mentalität, lernende Organisation, respektvolle Leistungskultur – Werte sichtbar in Rituale übersetzen.
Umsetzung und Unterstützung: Von der Idee zum belastbaren Plan
Damit aus der Methodik gelebte Praxis wird, empfehlen sich klare Routinen und, wo sinnvoll, gezieltes Mentoring mit Branchenfokus.
- 90‑Tage‑Zyklus als Standard: Jedes Quartal ein fokussiertes Ziel (KPI), drei Hebelmaßnahmen, ein Stakeholder‑Plan, ein Risiko‑Radar, eine Lern‑Hypothese – plus Review mit Sponsor.
- Lern‑Sprints planen: 6 Sprints pro Jahr zu Ihrem Kompetenz‑Stack (PSM/EHS, GMP/Qualität, Lean/OEE, CAPEX, Data/Storyline, Führungspräsenz) mit direkter Anwendung im Werk.
- Evidenzlogbuch führen: wöchentlich 15 Minuten; Soft‑Skill‑Evidenz an harte Ergebnisse koppeln. Das Logbuch ist Ihr stärkstes Werkzeug für Beförderungen und Wechsel.
- Sponsorengespräche institutionalisieren: monatlich 20 Minuten; Status, Blocker, Stakeholder‑Temperatur, nächster Meilenstein.
- Projektpipelining: mindestens ein laufendes Impact‑Projekt und ein vorbereitetes Nachfolgeprojekt; so bleibt Ihre Wirkung kontinuierlich sichtbar.
Wenn Sie diese Schritte mit einem erfahrenen Sparringspartner aus der Chemie/Produktion gehen möchten, bietet Young professional’s coaching von Dr. Michael Bessel wertebasiertes, individuell zugeschnittenes Mentoring – mit klarer Branchenfokussierung, internationaler Erfahrung und Praxis aus eigener Linien‑ und Standortverantwortung. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihren Status, schärfen die Rollen‑These und priorisieren die nächsten messbaren Meilensteine – damit jede Ihrer Stationen die Tür zur nächsten Führungsstufe öffnet.
Kontakt:
- E‑Mail: info@young-professionals-coaching.de
- Telefon/WhatsApp: +49 (0)176 227 127 67
- Website: Young professional’s coaching (DE/EN), Kontaktformular sowie weitere Publikationen/Downloads, u. a. „Überzeugend Bewerben – worauf Entscheider wirklich achten“.
Führen, Wirken, Wachsen – Blog für Chemie & Produktion
Praxisnahes Know-how von Dr. Michael Bessel für Karriere und Leadership in Chemie und Verfahrenstechnik: strategische Laufbahnplanung, souveräne Kommunikation, überzeugend bewerben, Führungswerkzeuge jenseits der Gehaltserhöhung, Resilienz und wirksame Teamentwicklung – mit Einblicken aus internationaler Linien- und Standortverantwortung für Studierende, Young Professionals und Führungskräfte.
Ihr 18‑Monats‑Zielbild: Vom Projektmitarbeiter zur Führungsverantwortung in Chemie und Produktion
In der Chemie und Produktion werden Führungsrollen nicht allein nach Seniorität vergeben, sondern nach sichtbarer, verlässlicher Wirkung auf Safety, Qualität und Output. Dieser 18‑Monats‑Plan richtet sich an Young Professionals und angehende Führungskräfte, die Verantwortung aufbauen und messbar liefern wollen – ohne Selbstdarstellung, dafür mit Substanz.
Leitplanken für Ihr Zielbild:
- Verantwortungsumfang: Vom eigenständigen Projektstream über die Koordination einer Schicht-/Linienübergabe bis hin zur stellvertretenden Leitung eines Themenbereichs (z. B. Instandhaltungskoordination, Qualifizierungsprogramm, OPEX/TPM‑Baustein).
- Wirksamkeitsbelege: Verbesserungen in FPY (First‑Pass‑Yield), OEE (Gesamtanlageneffektivität), Abweichungsmanagement (Termintreue, CAPA‑Wirksamkeit) und messbare Cost‑Saving‑Cases.
- Führungssignale: Vertrauensbildende Kommunikation mit betriebsrelevanten Stakeholdern, sichere Entscheidungsfähigkeit unter Zeit- und Compliance‑Druck, Förderung von Teamkompetenz und Safety‑Kultur.
Phasenstruktur (18 Monate):
- Monate 0–3: Orientierung und Stärken‑Mapping, Kompetenzrahmen „entschlüsseln“, Ausgangswerte (Baseline) erfassen, Entscheidungsjournal aufsetzen.
- Monate 4–9: Gezielt „Stretch‑Assignments“ übernehmen (Turnaround‑Module, Scale‑up‑Runs, TPM/Six Sigma). Skill‑Stack systematisch ausbauen.
- Monate 10–15: Ergebnisse skalieren und stabilisieren, Meilensteine reporten, Junioren anleiten, Stellvertretung übernehmen.
- Monate 16–18: Verantwortungsbereich formalisieren (Rollenklärung, Übergabedokumente, KPI‑Dashboard), Nachfolge/Vertretung entwickeln.
Zentrale Regel: Jede Aktivität muss auf mindestens einen geschäftskritischen Treiber einzahlen – Safety, Qualität oder OEE. Alles andere ist optional.
Stärken kartieren, Profile entschlüsseln, Kompetenzlücken schließen
1) Stärken‑Mapping auf Safety, Qualität, OEE
- Inventur: Listen Sie Ihre drei stärksten fachlichen und drei stärksten verhaltensbezogenen Stärken (z. B. HAZOP‑Disziplin, saubere Datenanalyse, ruhiges Auftreten in Störungen).
- Geschäftskritische Übersetzung:
- Safety: HAZOP/LOPA‑Erfahrung, MOC‑Konsequenz, PSA‑Vorbild, Lessons Learned in die Fläche bringen.
- Qualität: GMP/ISO‑Verständnis, Abweichungsanalyse (RCA, 5‑Why), CAPA‑Nachverfolgung, SPC‑Routine.
- OEE: Verlustbaum (Verfügbarkeit, Leistung, Qualität) beherrschen, Engpassdiagnose, Rüstzeit‑Reduktion (SMED), FPY‑Steigerung.
- Passungscheck: Bilden Sie konkrete „Stärke‑x‑Wert“-Paare, z. B. „Strukturierte RCA“ → „CAPA‑Wirksamkeit binnen 60 Tagen“.
2) Stellenprofile und Kompetenzrahmen richtig „entschlüsseln“
- Semantik lesen: Achten Sie auf Verben („führen“, „steuern“, „sicherstellen“) und Kontexte (Schichtbetrieb, ATEX, Scale‑up), um implizite Verantwortung zu erkennen.
- Kompetenzmatrix: Ordnen Sie Anforderungen in „Must‑have“, „Build‑now“ (innerhalb 6 Monate), „Nice‑to‑have“.
- Unternehmensrahmen: Beziehen Sie interne Frameworks (z. B. Leadership‑Dimensionen, Technical Ladder) ein, um Lernpfade zu planen und Evaluationskriterien zu verstehen.
- Evidenz planen: Definieren Sie für jedes „Build‑now“ einen Praxisnachweis (Audit‑Vorbereitung, A3‑Report, Shopfloor‑Training).
Sofort nutzbare Vorlage 1 – Kompetenz‑Portfolio (1 Seite)
- Kopf: Name, aktuelle Rolle, Zielrolle in 18 Monaten
- Schlüsselstärken: 3 fachlich, 3 verhaltensbezogen, mit je einem Safety/Qualität/OEE‑Beleg
- Kompetenzmatrix: Must‑have/Build‑now/Nice‑to‑have mit geplanter Evidenz (Projekt/Artefakt)
- KPI‑Baseline: FPY, OEE, Abweichungs‑Abarbeitungszeit, Kosten/Nutzen‑Case (Ist)
- Lerneinheiten: Kurze Maßnahmenliste (Mentoring, Schulung, On‑the‑Job)
3) Skill‑Stack aufbauen: Kommunikation, Argumentation, Präsenz, Resilienz
- Souveräne Kommunikation: Klare Ziele, kurze Sätze, Risiko/Impact/Optionen, verbindliche Next Steps. Trainieren Sie „Executive Summaries“ für 60–90 Sekunden.
- Strukturierte Argumentation: SCQA/Pyramidenprinzip nutzen, Daten sauber visualisieren (Run‑Charts, Pareto, Ishikawa), Entscheidungen herleiten statt behaupten.
- Präsenz: Auftritt am Shopfloor und im Audit – Blickkontakt, ruhige Stimme, prägnante Storyline, Sicherheit zuerst signalisieren.
- Resilienz: Arbeitslast priorisieren (Critical Path vs. Busy‑Work), Pausen und Eskalationsroutinen definieren, „Recovery‑Blocks“ im Kalender.
Die richtigen Stretch‑Assignments: Turnaround, Scale‑up, TPM/Six Sigma – mit Wirkung
Kriterien zur Auswahl eines Stretch‑Assignments:
- Geschäftsrelevanz: Klarer Beitrag zu Safety/Qualität/OEE mit quantifizierbarem Ziel.
- Lernspannung: Fordert neue Kompetenz (z. B. CAPEX‑Koordination, Lieferantenqualifizierung).
- Sponsorship: Benannter Sponsor aus Linie oder EHS/QA. Zugriff auf Daten, Budget, Zeitfenster.
- Machbarkeit: Realistischer Scope, klarer kritischer Pfad, definierte Abnahmekriterien.
Beispiele:
- Turnaround/Stillstand: Verantworten Sie ein Arbeitspaket (z. B. Kolonnentausch inkl. MOC‑Abschluss). Ziel: 0 LTI, fristgerechte Freigabe, OEE‑Startwert +x% nach Wiederanlauf.
- Scale‑up/Pilot zu Produktion: Führen Sie die tech transfer‑Checkliste, qualifizieren Sie kritische Parameter (DoE), sichern Sie den ersten FPY > 92%.
- TPM/Six Sigma: Moderieren Sie ein Kaizen zu einer Verlustart (Mikrostillstände), etablieren Sie ein Schicht‑KVP‑Board, sparen Sie 50 k€ p. a. nachweislich ein.
Sofort nutzbare Vorlage 2 – 1‑Seiten‑Impact‑Story (für Reviews und Leadership‑Updates)
- Kontext: Problem, Risiko, betroffene Linie/Anlage
- Ziel/KPI: Klarer Sollwert (z. B. FPY +5 pp, CAPA‑Durchlaufzeit –30%)
- Maßnahmen: 3–5 Hebel (mit Verantwortlichen und Terminen)
- Ergebnisse: Vorher/Nachher, Kosten‑Nutzen, Lessons Learned
- Nächste Schritte: Standardisierung, Training, Übergabe
Praxisrhythmus:
- Monat 4: Auswahl und Scoping mit Sponsor
- Monate 5–7: Umsetzung in Sprints (2–3 Wochen), wöchentlicher Shopfloor‑Takt
- Monate 8–9: Stabilisierung, Standard‑Work, Audit‑Readiness, Ergebnispräsentation
Stakeholder‑Landkarte, vertrauensbildende Kommunikation und Sichtbarkeit ohne Selbstdarstellung
Stakeholder‑Landkarte in Chemie/Produktion:
- Schichtteams: Fokus auf sichere, stabile Abläufe; erwarten klare Standards, verlässliche Eskalation und respektvollen Umgang.
- EHS: Compliance, Risikoabbau, Vorbildfunktion; schätzen Proaktivität und saubere Dokumentation.
- Instandhaltung: Verfügbarkeit, planbare Zugriffe, Ersatzteillogistik; brauchen frühzeitige Info und realistische Fenster.
- QA/Qualitätssicherung: Datenintegrität, Auditfestigkeit, Abweichungsmanagement; erwarten stringente CAPA und Change Control.
- Einkauf/Lieferanten: Qualität/Termine/Kosten, SLAs; benötigen präzise Spezifikationen und Entscheidungsfreigaben.
- Betriebsrat: Arbeitsbedingungen, Qualifizierung, Schichtmodelle; frühzeitig einbinden bei Änderungen, transparent kommunizieren.
Vertrauensbildende Kommunikation:
- Safety‑Anker zuerst: Beginnen Sie Meetings mit der relevanten Safety‑Lage (Permit‑Status, neue Risiken, Lessons Learned).
- Fakten vor Meinung: Zeigen Sie Prozessdaten, Trends, Audit‑Findings; kennzeichnen Sie Hypothesen.
- Konsistenz: Ankündigen, liefern, nachhalten – Protokolle und Action‑Tracker sind Ihre Währung.
- Anerkennung: Erfolge teamzentriert berichten, Beiträge der Schicht/Instandhaltung sichtbar machen.
Sichtbarkeit ohne Selbstdarstellung:
- Artefakte sprechen lassen: A3‑Reports, stabile Standard‑Work, Dashboards auf dem Shopfloor.
- Review‑Rituale: Monatliche 15‑min‑Updates im Führungskreis anhand der 1‑Seiten‑Impact‑Story, mit klaren Zahlen.
- Wissen teilen: Kurzschulungen (Toolbox‑Talks), 10‑Minuten‑Lessons Learned nach CAPA‑Schluss.
Messbare Meilensteine definieren:
- FPY: Baseline, Ziel, Maßnahmenplan, Wochen‑Monitoring.
- Abweichungsmanagement: Zeit bis Root Cause, Zeit bis CAPA‑Wirksamkeitsprüfung, „Overdue“-Quote < 5%.
- Cost‑Saving‑Cases: Klarer Finanzrahmen, validierte Annahmen, Finance‑Abnahme.
Entscheidungsjournal (wöchentlich 15 Minuten):
- Kontext: Entscheidung, Datum, beteiligte Stakeholder
- Optionen: A/B/C mit Risiken und Annahmen
- Entscheidung: Begründung, erwarteter Impact
- Ergebnis: Nach 4–6 Wochen prüfen, Learnings festhalten
- Transfer: Welche Regel/Checkliste wird angepasst?
Typische Fallen und Gegenmaßnahmen:
- Busy‑Work: Alles, was weder Safety/Qualität/OEE verbessert noch Kompetenzen aufbaut, konsequent eliminieren oder delegieren.
- Meeting‑Falle: 30‑Minuten‑Default, klare Agenda, Entscheidungen dokumentieren; „No‑Deck“-Stand‑ups am Shopfloor bevorzugen.
- „Alleinlöser“-Bias: Früh eskalieren, Pairing mit EHS/QA/ME; Verantwortung teilen, Ownership behalten.
Expat/Standortwechsel‑Checkliste, 90‑Tage‑Onboarding und Ihr 18‑Monats‑Takt
Expat/Standortwechsel‑Checkliste (Auswahl):
- Compliance: Visa/Arbeitserlaubnis, medizinische Freigaben, Sicherheitsunterweisungen (lokale Gesetzgebung, ATEX/PSM).
- Prozesse: Lokale SOPs, Change‑Control, Abweichungs‑ und Freigabewege.
- Technik: Anlagenbesonderheiten, Medienversorgung, Ersatzteilstrategie, kritische Lieferanten.
- Kultur & Sprache: Schlüsselwörter für Safety/Qualität, lokale Kommunikationsnormen, Betriebsratsstruktur.
- Netzwerk: Sponsor, Mentor, Buddy, EHS‑Ansprechperson, QA‑Partner, Instandhaltungsschicht.
- Privatlogistik: Wohnung, Transport, Notfallkontakte, Krankenversicherung.
- Erfolgssignale: Drei realistische 90‑Tage‑Outcomes (z. B. stabile Übergabeprotokolle, erstes Kaizen, Audit‑Walk‑Through bestanden).
Sofort nutzbare Vorlage 3 – 90‑Tage‑Onboarding‑Canvas
- Ziele (3): Safety, Qualität, OEE – je ein konkretes Ergebnis
- Stakeholder: Top‑5‑Kontakte mit Rhythmus (wöchentlich/monatlich)
- Lernpfad: SOPs/Trainings, Werksrundgänge, Schatten‑Tage
- Quick Wins (≤30 Tage): 2–3 sichtbare Verbesserungen
- Risiken/Countermeasures: Top‑3‑Risiken mit präventiven Maßnahmen
- Review‑Termine: Tag 30/60/90 mit Sponsor
Ihr 18‑Monats‑Takt – komprimiert:
- Monate 0–3 (Fundament): Kompetenz‑Portfolio erstellen, Baselines erfassen, Stakeholder‑Landkarte aufbauen, Entscheidungsjournal etablieren.
- Monate 4–6 (Quick Wins): Erstes Stretch‑Assignment mit klarer KPI, 1‑Seiten‑Impact‑Story nutzen, Präsenz stärken (Shopfloor‑Routinen).
- Monate 7–12 (Skalieren): Zweites Assignment (z. B. Six Sigma/TPM), Standardisierung, Trainings multiplizieren, FPY/OEE stabil verbessern.
- Monate 13–15 (Führen durch Wirkung): Stellvertretung übernehmen, Junioren coachen, Audits sicher führen, Cost‑Saving‑Case validieren.
- Monate 16–18 (Formalisieren): Rolle schärfen, Verantwortungen übergeben, Kennzahlen im Leadership‑Review verankern, Nachfolge sichern.
Woran Sie Ihren Fortschritt erkennen:
- Inhalte: Sie sprechen in Kennzahlen, nicht in Adjektiven. Ihre A3s und Dashboards sind aktuell.
- Verhalten: Stakeholder suchen aktiv Ihren Rat; Sie moderieren Zielkonflikte (Safety vs. Output) souverän.
- Wirkung: Verbesserungen halten; Audits verlaufen professionell; Sie befähigen andere, statt selbst „Feuer zu löschen“.
Wenn Sie diese Schritte konsequent gehen, entsteht Führung aus gelebter Verantwortung. Für die Feinjustierung – etwa bei der Auswahl der richtigen Stretch‑Assignments im Schichtbetrieb, der Vorbereitung auf Expat‑Einsätze oder beim Aufbau einer wirksamen Kommunikationsroutine – lohnt sich ein sparringsstarkes, branchenkundiges Mentoring. In einem kostenlosen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele, prüfen Baselines und priorisieren die nächsten 90 Tage so, dass die 18‑Monats‑Meilensteine in Reichweite kommen.
Präsenz hinter Helm und Maske: Souveräne Führung und sichere Kommunikation in Chemie und Schichtbetrieb
In der Chemieproduktion und im Schichtbetrieb ist persönliche Schutzausrüstung (Helm, Brille, Maske, Gehörschutz) Pflicht – und genau deshalb wird nonverbale Präsenz zur Führungsaufgabe. Wo Mimik verdeckt ist, trägt Ihre Haltung Verantwortung: für Sicherheit, für Vertrauen im Team, für die Wirksamkeit von Anweisungen. Präsenz bedeutet hier nicht „laut“ oder „dominant“, sondern klar, verlässlich und anschlussfähig zu wirken – damit Menschen auch unter Zeitdruck, Lärm und Risiko koordiniert handeln.
Wesentliche Hebel:
- Haltung: Stabiler, geerdeter Stand (Fuße parallel, Schulterbreite), Schultern tief, Brustbein leicht angehoben. Das signalisiert Kontrolle und Ruhe.
- Blickführung trotz Schutzbrille: Richten Sie den Kopf deutlich in Richtung Ihres Gegenübers; nutzen Sie Mikronicken. Da Augen weniger sichtbar sind, zählt die Kopf- und Körperausrichtung doppelt.
- Gestik: Mit Handschuhen und Clipboards gehen Feinheiten verloren. Arbeiten Sie mit klaren, langsamen, „geometrischen“ Gesten (offene Handflächen, flache Hand zum Stoppen, zwei Finger für „zwei Schritte“). Vermeiden Sie hektische Bewegungen.
- Stimme: Tragen Sie die Stimme über den Atem, nicht über Kraft. Kurze Sätze, prägnante Verben, deutliche Pausen. Nutzen Sie das „Closed-Loop“-Prinzip: Auftrag geben, Wiederholung einfordern, bestätigen.
Hinweis: Diese Empfehlungen ergänzen geltende Sicherheitsvorschriften (Betriebsanweisungen, Ex-Schutz, LOTO etc.) und ersetzen sie nicht. Sicherheit hat Vorrang vor Wirkung – Präsenz unterstützt sichere Führung, sie darf niemals Schutzregeln relativieren.
Präsenz in Schlüsselsituationen: Schichtübergaben, Safety-Talks, Störfall-Lagen und Audits
Schichtübergabe
- Ziel: Lagebild synchronisieren, Risiken antizipieren, Verantwortlichkeiten klären.
- Vorgehen: Positionieren Sie sich seitlich an der Tafel/Monitorwand, nicht davor. So bleibt die Information sichtbar. Blickführung im Dreieck: Person A – Person B – Visualisierung.
- Stimme und Struktur: „Drei-Punkte-Regel“ – Zustand der Anlage, kritische Abweichungen, Maßnahmen/Nächste Schritte. Jede Maßnahme mit Namen+Zeitpunkt abschließen („Frau Keller, Sie prüfen Ventil 3 um 14:30 Uhr – korrekt?“).
- Geste: Offene Handflächen bei Übergaben („Ich gebe an Sie ab“), klarer Schlussanker (kurzer Blick in die Runde, Nicken, „Bestätigung bitte“).
Safety-Talk/Toolbox-Meeting
- Do: Beginnen Sie mit einem 30‑Sekunden‑„Why Safety“ in ruhiger, tiefer Stimmlage. Visualisieren Sie mit einfachen, großen Gesten (Gefahrenzone als „Rechteck“ in der Luft).
- Do: Closed-Loop-Safety („Was ist die größte Gefahr heute?“ – „Heißarbeit Bereich B“ – „Wie sichern wir?“ – „Freimessen, Brandschutzposten, Löschmittel bereit“ – „Bestätigt.“).
- Don’t: Von hinten zur Gruppe sprechen; in den Wind schreien; Clipboards vor Brustkorb „parken“ (blockiert die Offenheit). Nicht mit unklaren Kopfbewegungen „abwinken“.
Störfall- und Störungslagen
- Führungskern: Präsenz = Ruhe + Klarheit + Kürze. Reduzieren Sie Wortwahl auf Fakten und Anweisungen. Keine Spekulationen am Einsatzort.
- Körper: Füße fest, Gesicht offen zur Mannschaft, freie Hände. Wenn Sie deuten müssen, nutzen Sie die flache Hand, nicht den Zeigefinger.
- Stimme: Tiefer ansetzen, langsamer werden, mit Pausen führen. Funkdisziplin (Rufzeichen, Auftrag, Rückmeldung). Priorisieren Sie geschlossene Frageformen („Ist Bereich C geräumt? – Ja/Nein“).
- Blick: Kopfbewegungen deutlich; bei Atemschutz/Maske mit überdeutlichem Nicken arbeiten. Nutzen Sie Sichtkontakt-„Beacons“: kurze, gezielte Fixierung auf die jeweils verantwortliche Person.
Audits und Begehungen
- Auftakt: Klare Begrüßung, Name/Funktion, Ablauf in drei Schritten ankündigen. Die Hände sichtbar und ruhig; Helm- und Brillenriemen korrekt – Vorbildwirkung.
- Vor Ort: Bleiben Sie auf der „Sicherheitslinie“ (Gehwege, Markierungen). Beantworten Sie Fragen mit SAR-Struktur (Situation – Aktion – Resultat). Zeigen schlägt Erzählen: Logbuch, Freigabeschein, Checklisten.
- Don’t: Diskutieren über hypothetische Ausnahmen; „Überreden“ statt nachvollziehbar erklären. Kein Fingerzeigen auf Mitarbeitende – Verantwortung wird im Prozess gezeigt, nicht auf Personen abgewälzt.
Do’s & Don’ts mit PSA, Funkgerät und Clipboard
- Do: Funkgerät so tragen, dass die Mikrofonnahme frei ist; vor dem Einsatz ein Testcall. Sprechknopf erst drücken, dann atmen, dann sprechen.
- Do: Clipboard seitlich halten oder ablegen; bei Gesprächen Oberkörper frei. Seiten markieren, damit Blättern nicht zum Unruhe-Faktor wird.
- Do: Gesten größer, aber langsamer ausführen; Handschuhe nehmen Feinmotorik – daher bewusst dosieren.
- Don’t: Helmvisier als „Zeiger“ verwenden; nicht mit Gerät auf Menschen deuten. Keine verschränkten Arme über PSA – signalisiert Abwehr und blockiert Atmung.
Distanzzonen im Ex-Bereich
- Sicherheitsabstand ist nicht verhandelbar. Soziale Nähe erzeugen Sie über Körperausrichtung, Stimme und klaren Auftrag – nicht durch Näherkommen.
- Faustregel: Halten Sie Markierungen und Mindestabstände ein; arbeiten Sie mit seitlicher Positionierung in „L“-Form zur Gruppe, um Sicht und Schall zu optimieren.
- Bei Lärm/Gehörschutz: Direktionsgesten verstärken (Stop-Geste, Richtungsfläche). Vereinbaren Sie vorab visuelle Signale (Daumen hoch = verstanden; Handfläche hoch = Stopp).
Interkulturelle Nuancen im Expat-Umfeld
- Blickkontakt: In einigen Kulturen kürzer/indirekter Blick üblich. Signalisieren Sie Aufmerksamkeit über Körperausrichtung und Zusammenfassen in eigenen Worten.
- Gestik: Zeigefinger kann als aggressiv empfunden werden; offene Hand bevorzugen. „OK“-Zeichen, Daumen, Nicken haben teils abweichende Bedeutungen – vorher abstimmen.
- Distanz: Persönliche Distanzzonen variieren. Halten Sie betriebliche Sicherheitsabstände, erklären Sie Ihr „Warum“ („Ich bleibe hier wegen Ex-Zone/Überblick“).
- Sprache: Einfaches Englisch/Deutsch, Fachbegriffe sparsam. Backbrief im Team verankern („Can you repeat the task in your own words?“).
Mikro-Habits und Kurzübungen: 60‑Sekunden‑Reset, Anker-Gesten und Teamleiter-Drills
60‑Sekunden‑Reset (für Schlüsselmomente)
- Stand: Füße parallel, Knie locker, Gewicht mittig. Schuhe erden – fühlen Sie den Boden.
- Atem: 4 ruhige Atemzüge, Ausatmen länger als Einatmen. Beim Ausatmen Schultern sinken lassen.
- Blick/Headset: Kopf neutral, Kinn leicht zurück. Visier/Brille justieren, damit der Blick frei ist.
- Stimme: Ein Satz zur Fokussierung flüstern („Klar, ruhig, präzise.“). Dann erste Worte in mittlerer Lautstärke mit deutlicher Betonung.
- Ergebnis: Puls sinkt, Stimme trägt, Gestik wird gezielter. Perfekt vor Übergaben, Störungslagen, Auditfragen.
Anker-Gesten
- „Stopp sicher“: Flache Hand auf Brusthöhe, 1 Sekunde halten. Verbindet Klarheit mit Respekt.
- „Ich übernehme/ich übergebe“: Beide Handflächen offen, leichte Vorwärtsbewegung bzw. Rücknahme.
- „Verstanden?“: Daumen seitlich anheben plus kurzes Nicken. Vorab im Team etablieren.
- Tipp: Wiederholen Sie Anker-Gesten bewusst in Routinegesprächen, damit sie in Stresslagen automatisch abrufbar sind.
Kurzübungen für Teamleiter:innen (à 5–8 Minuten)
- Drill 1 – Schichtübergabe in 90 Sekunden: Eine Person fasst die Lage in 3 Punkten zusammen. Fokus auf Kopf-/Körperausrichtung, Blickdreieck, klare Abschlussfrage. Feedback durch Beobachter an drei Kriterien: Haltung, Stimme, Struktur.
- Drill 2 – Funk im Lärm: In Hallenumgebung per Funk drei Aufträge erteilen (je 10 Wörter). Closed-Loop prüfen. Übung mit Timer und Standardrufzeichen.
- Drill 3 – Safety-Talk ohne Tafel: Gefahren einer Aufgabe mit „Luft-Bild“ beschreiben (Rechteck für Zone, Pfeil für Bewegungsrichtung). Ziel: Gestik verlangsamen, Bilder sprechen lassen.
- Drill 4 – Interkulturelles Echo: Eine Anweisung auf Deutsch, einmal auf einfaches Englisch. Gegenüber fasst jeweils zusammen. Fokus: Tempo halbieren, Verben priorisieren, Füllwörter streichen.
Transfer sichern
- Ein-Minuten-Logbuch: Nach jeder Schlüsselkommunikation drei Stichpunkte notieren (Was wirkte? Was irritierte? Was ändere ich?). Nach zwei Wochen Muster auswerten.
- Peer-Coaching: Tandems bilden; wechselseitige Beobachtung bei Toolbox-Meetings mit kurzem Debrief (2 Fragen: „Was hat Vertrauen erzeugt?“ „Wo war ich unklar?“).
Präsenz übersetzen: Wie sich Ihre Wirkung in Interviews und Beförderungsgesprächen zeigt
Entscheider achten nicht auf Floskeln, sondern auf evidenzbasierte Wirkung. Übertragen Sie Ihre Präsenz aus der Produktion in klare, nachvollziehbare Geschichten – und zeigen Sie, dass Sie unter PSA führen können.
Worauf Entscheider wirklich achten
- Sicherheitsführung: Konkrete Beispiele geschlossener Sicherheitskreisläufe (Gefahr erkannt – Maßnahme ergriffen – Wirkung überprüft). Nennen Sie Kennzahlen oder Indikatoren (z. B. „X Freigaben konsequent mit Backbrief, Null Nacharbeiten“).
- Kommunikationsklarheit: Kurze Sätze, logische Struktur (STAR/SAR). Nachfragen antizipieren, Pausen setzen.
- Teamwirkung: Wie haben Sie Vertrauen aufgebaut, Konflikte entschärft, Schichtübergaben stabilisiert? Beschreiben Sie das „Wie“, nicht nur das „Was“.
- Interkulturelle Kompetenz: Beispiele aus Expat-/Projektkontexten mit Distanzzonen, Sprachwechsel, Gestenregeln – und wie Sie Missverständnisse proaktiv verhindert haben.
- Selbstführung: 60‑Sekunden‑Reset in Stressmomenten, bewusste Stimmeinsatz. Das signalisiert reflektierte Professionalität.
Praktische Übersetzungen
- Statt „Ich bin kommunikativ“: „Im Audit KW 34 habe ich Antworten im SAR-Format gegeben und jede Maßnahme am Logbuch gezeigt. Ergebnis: keine Major Findings.“
- Statt „Ich übernehme Verantwortung“: „Während einer Störung an Sumpfpumpe P‑204 habe ich mit Stop‑Geste gesichert, per Funk drei kurze Aufträge erteilt, Closed-Loop eingeholt und den Bereich in 4 Minuten geordnet – ohne zusätzliche Exposition.“
- Statt „Ich kann international“: „Im Expat-Einsatz in XXX habe ich Gesten standardisiert, Distanzzonen erklärt und Backbrief eingeführt. Folge: Null Sprachmissverständnisse bei Freigaben in drei Monaten.“
Vorbereitung auf das Gespräch
- Üben Sie Ihre Beispiele laut – mit Fokus auf Stimme und Pausen. Simulieren Sie Fragen im Stehen; Haltung und Atem stabilisieren die Botschaft.
- Packen Sie ein „Wirkungs-Portfolio“: 3 kurze Fallstudien, 1 Audit-Story, 1 Safety-Talk-Beispiel. Jeweils 60–90 Sekunden, mit greifbarem Resultat.
- Online-Interview? Blick kommt über die Kamera; Haltung bleibt sichtbar. Dieselben Präsenzprinzipien gelten – nur ohne Helm.
Checkliste zum Download: Präsenz hinter Helm und Maske
- Vor dem Gespräch/Einsatz: PSA sitzt, Funk getestet, Visuals bereit. 60‑Sekunden‑Reset durchführen.
- Haltung: Geerdeter Stand, offene Schultern, Hände sichtbar; Clipboard seitlich/abgelegt.
- Blickführung: Kopf klar zum Gegenüber/Gruppe; Mikronicken; Dreieck mit Visualisierung.
- Stimme: Kurze Sätze, deutliche Verben, Pausen; Closed-Loop einfordern.
- Gestik: Groß, langsam, offen; Stop‑Geste, Übergabe‑Geste, „Verstanden?“-Signal.
- Do’s & Don’ts: Keine verschränkten Arme; nicht mit Geräten zeigen; Funkdisziplin.
- Distanzzonen: Sicherheitsabstände strikt halten; Nähe über Ausrichtung und Stimme, nicht über Schritt nach vorn.
- Interkulturell: Gesten abstimmen, Tempo halbieren, Backbrief nutzen.
- Transfer: 1‑Minuten‑Logbuch führen; Peer‑Feedback einholen.
Sie möchten die Checkliste als PDF und kurze Übungskarten für Ihr Team? Laden Sie sie im Download‑Bereich der Website herunter oder fordern Sie sie per E‑Mail an: info@young-professionals-coaching.de. Für ein kostenloses Erstgespräch – z. B. zur Vorbereitung auf Audit, Beförderung oder Interview – erreichen Sie uns auch via WhatsApp oder telefonisch unter +49 (0)176 227 127 67.
Resilienz im Schichtbetrieb: Fünf praxisbewährte Hebel für sichere, lernstarke Chemieproduktion
Resilienz im industriellen 24/7‑Betrieb bedeutet nicht, „Härte zu zeigen“, sondern die Fähigkeit, Störungen frühzeitig zu erkennen, sicher zu stoppen, sauber zu lernen und schneller als zuvor wieder wirksam zu werden. Gerade in der Chemie- und Verfahrenstechnik greifen Prozesse tief ineinander: Leitwarte, Feld, Instandhaltung, Labor, Logistik und externe Partner. In diesem Netzwerk entscheidet die Qualität von Übergaben, Entscheidungen und Lernschleifen über Sicherheit, Qualität, Output – und über die psychologische Sicherheit des Teams.
Wertebasierte Führung sieht den Menschen im Mittelpunkt der Technik. Sie sorgt dafür, dass Mitarbeitende mit ihren Stärken an den richtigen Aufgaben arbeiten, auch wenn es hektisch wird. Resilienz ist dann kein „Extra“, sondern Teil der täglichen Routinen: wie wir Schichten übergeben, Abweichungen besprechen, Entscheidungen treffen und Wissen verteilen. Fünf Praxishebel haben sich in Hochlast- und 24/7‑Umgebungen besonders bewährt.
Fünf Praxishebel aus der Chemieproduktion
- Klare Schichtübergabe-Routinen: Lage – Lernen – Limits
Eine gute Übergabe ist kein Gespräch „zwischen Tür und Angel“, sondern eine strukturierte, wiederholbare Routine. Drei Fragen reichen, wenn sie konsequent gestellt werden:- Lage: Was ist der aktuelle Zustand? Anlagenstatus, kritische Parameter, offene Freigaben, anstehende Arbeiten (Permit-to-Work), besondere Risiken.
- Lernen: Was haben wir in der letzten Schicht gelernt? Kleine Abweichungen, Beobachtungen, Workarounds, neue Erkenntnisse aus Messwerten oder Probennahmen.
- Limits: Wo liegen heute unsere Grenzen? Engpässe bei Personal/Kompetenzen, Material, Equipment oder Genehmigungen. Welche Schutz- und Eskalationskriterien gelten?
- Nutzen Sie ein standardisiertes Handover-Board (physisch/digital) mit Checkliste und Zeitfenster (z. B. 10–15 Minuten, ungestört).
- Rollen klären: Wer übergibt, wer übernimmt, wer protokolliert? Entscheidungen und offene Punkte sichtbar festhalten.
- Fallstrick: Übergaben in die Pausen oder an den Anlagenrand „auslagern“. Ergebnis: Wissensverlust, stille Annahmen, mehr Störungen.
- Kurze After-Action-Reviews (AAR) nach Abweichungen
Lernen braucht Takt. Nach jeder relevanten Abweichung oder Störung ein Mini‑AAR von 10–20 Minuten:- Was war geplant?
- Was ist passiert?
- Warum ist es passiert (erste Ursache, nicht die „Schuldfrage“)?
- Was lernen wir daraus?
- Wer tut was bis wann?
- AAR so nahe wie möglich am Ereignis durchführen (noch in der Schicht), moderiert, faktenbasiert.
- Ein „Learning Log“ führt Entscheidungen, Hypothesen, nächste Schritte. Kleine Korrekturen sofort testen („Ein-Punkt-Experimente“).
- Fallstrick: Aus einem AAR eine Ursachenanalyse mit Perfektionsanspruch machen. Folge: Verzögerungen, Frust, kein kurzfristiger Nutzen.
- Klare Entscheidungs- und Eskalationspfade: Stop-the-line ohne Gesichtsverlust
Sicherheits- und Qualitätsrisiken dulden keinen Aufschub. Gleichzeitig dürfen Stopps nicht als persönliches Scheitern wahrgenommen werden.- Definition: Wofür hat jede Rolle Entscheidungsfreiheit? Welche Parameter/Schwellen führen zum Stopp? Welche Eskalationsstufen greifen?
- Neutrales Signal: Ein standardisiertes „Stop-the-line“-Signal (visuell/akustisch) entpersonalisiert den Moment. Es aktiviert einen bekannten Ablauf.
- Sprache: Faktenformeln nutzen („Ich beobachte… ich bewerte das Risiko als… Empfehlung: Stopp gemäß Kriterium X“).
- Trainieren Sie das Stoppen explizit im Team, inklusive „Trockenübungen“ in Schichtmeetings.
- Führungskräfte würdigen die Entscheidung zu stoppen; Fokus auf Informationsqualität, nicht auf „Schuldige“.
- Fallstrick: Eskalationen nur informell („kurzer Anruf“) regeln. Ergebnis: Intransparenz, Verzögerungen, Doppelarbeit.
- SBAR-Standards für Leitwarte – Feld – Instandhaltung
SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) bringt Tempo und Klarheit in kritische Kommunikation.- Situation: „Welche Anlage? Welcher Alarm? Zeit, Ort, betroffene Einheiten?“
- Background: „Relevante Historie, letzte Eingriffe, laufende Freigaben, besondere Betriebszustände?“
- Assessment: „Hypothese zur Ursache, Risiken für Sicherheit/Qualität/Umwelt?“
- Recommendation: „Konkreter Vorschlag: drosseln, stoppen, Messung X, Freigabe Y einholen.“
- Laminierte SBAR‑Karten an Leitständen und in Einsatzfahrzeugen; SBAR‑Felder in Leitwarten- oder CMMS‑Tickets.
- Funkdisziplin: Erst SBAR, dann Diskussion. So bleiben Funksprüche kurz, vollständig und verwertbar.
- Fallstrick: SBAR als „Bürokratie“ abtun. Ergebnis: lange, unstrukturierte Gespräche, Missverständnisse, langsamere Störungsbehebung.
- Cross‑Training für kritische Rollen
Resiliente Teams vermeiden „Single Points of Failure“. Kompetenz wird bewusst verteilt.- Skills‑Matrix: Für jede Anlage/Funktion Klarheit über Mindestkompetenzen je Rolle und verfügbare Vertretungen.
- Mikro‑Trainings im Schichttakt: 10‑Minuten‑Spots zu einem Handgriff, einer Checkliste oder einem Alarmbild. „Sehen – Vormachen – Nachmachen – Feedback“.
- Geplante Rotationen: Zielgerichtete Einsätze in Leitwarte, Feld und Instandhaltung, um Systemverständnis zu vertiefen.
- Start mit 3–5 kritischsten Aufgaben pro Bereich; klare Lernziele und Nachweise (z. B. Freigabestufen).
- Verknüpfen Sie Cross‑Training mit Karrierepfaden – Kompetenzgewinn sichtbar anerkennen.
- Fallstrick: Nur „Schattenläufe“ ohne klare Lernziele. Ergebnis: Schein‑Sicherheit, keine abrufbare Kompetenz in der Störung.
Früh wirksam werden: Impulse für Berufseinsteiger:innen
Sie können Resilienz aktiv mitgestalten – von Tag eins an.
- Beobachtungen strukturiert melden: Nutzen Sie SBAR auch für „kleine“ Auffälligkeiten. Beispiel: „S: Pumpe P‑101 vibriert stärker. B: seit Filterwechsel gestern, keine weiteren Eingriffe. A: mögliche Verblockung, steigender Strom. R: Temperatur-Check, Inspektion Sieb, ggf. Lastreduzierung um 10 %.“
- Buddy‑System: Bitten Sie um eine:n Buddy aus der Nachbarschicht oder einem anderen Bereich. Ziel: schnelleres Onboarding, kürzere Wege, mehr Sicherheit beim Stop‑the‑line.
- Mikroresiliente Gewohnheiten:
- Vor der Übergabe 5 Minuten „Lagecheck“ am Board: Was muss heute sicher funktionieren? Was ist neu?
- Nach Störungen zwei Stichworte ins Learning Log – am besten direkt mit „Wer tut was bis wann?“
- „Sprechbar“ sein: Wenn unklar, SBAR nutzen, Rückfragen stellen, Annahmen laut machen.
- Mini‑AAR anstoßen: Schlagen Sie nach Abweichungen eine 10‑Minuten‑Reflexion vor. Formulieren Sie die Lernfrage wertschätzend: „Was hat uns heute geholfen – was machen wir morgen anders?“
- Eigene Lernpfade planen: Klären Sie mit Ihrer Führungskraft die 3 wichtigsten Kompetenzen für Ihre Rolle und wie Sie diese im Schichtalltag praxisnah aufbauen (Mikro‑Trainings, Shadowing mit Ziel, dokumentierte Freigaben).
Typische Fallstricke für Einsteiger:innen:
- Zu viel „Einzelkämpfen“ aus Respekt – statt strukturierter Rückfragen.
- Beobachtungen „parken“, weil man den perfekten Befund abwarten will.
- SBAR und Checklisten als Starrheit missverstehen – tatsächlich schaffen sie Freiraum für gutes Urteilsvermögen.
Für Nachwuchs- und Standortleiter:innen: Messen, führen, beschleunigen
Resilienz sichtbar machen heißt, Leading Indicators statt nur Lagging Indicators zu verfolgen.
- Near‑Miss‑Quote: Nicht als „Vorfallzahl“, sondern als Lernrate interpretieren. Wichtig ist die Qualität der Meldungen (SBAR‑Reife) und die Quote umgesetzter Gegenmaßnahmen.
- Umsetzgeschwindigkeit: Zeit von „Abweichung entdeckt“ bis „wirksame Maßnahme verankert“. Ziel: Tage statt Wochen. Engpass sichtbar machen (Entscheidungsfreigaben, Ersatzteile, Verantwortlichkeiten).
- Psychologische Sicherheit: Kurze, anonyme Pulschecks pro Schicht („Konnte ich heute Bedenken ohne Nachteile äußern?“, Skala 1–5) und Beobachtungen in Gemba‑Dialogen.
Gemba‑Dialoge im Schichttakt:
- 10–15 Minuten an der Anlage/Leitwarte, mit klarem Fokus: Lage – Lernen – Limits; ein offener Punkt wird vor Ort gelöst oder konkret terminiert.
- Führung hört zuerst, fasst in SBAR zusammen, bestätigt die nächsten Schritte mit Verantwortlichkeiten.
- Jede Woche ein „Lernthema der Woche“ sichtbar machen: Was hat die Organisation gelernt? Wo wurden Limits aktiv anerkannt und Konflikte sauber eskaliert?
Beispiele aus internationalen Start‑ups/Turnarounds:
- Start‑up in einer neuen Produktionslinie: Einführung eines täglichen, schichtübergreifenden SBAR‑Huddles (15 Minuten). Ergebnis: schnellere Freigaben, konsistente Kommunikation mit Instandhaltung, messbar kürzere Stillstandszeiten.
- Turnaround in einer Bestandsanlage: „Stop-the-line“-Training inklusive Rollenspielen, ergänzt um anonymes „Stopp‑Signal“ per Andon‑Knopf. Ergebnis: Stopp‑Hemmung sank, Near‑Miss‑Meldungen stiegen kurzfristig, gefolgt von Rückgang tatsächlicher Abweichungen.
- Greenfield‑Projekt mit hohem Expat‑Anteil: Cross‑Training mit klaren Kompetenzstufen und dokumentierten Freigaben; Lernlandkarte je Rolle. Ergebnis: Belastbare Vertretung in Urlaubs- und Krankheitsphasen, stabile Qualität trotz Teamwechseln.
Typische Führungs‑Fallstricke:
- Metriken ohne Dialog: Zahlen werden berichtet, aber nicht besprochen – keine Verhaltensänderung.
- „Lessons learned“ ohne Verantwortliche und Termine – Vereinbarungen verpuffen.
- Überfrachtete Tools, die in der Hitze des Schichtalltags nicht anwendbar sind.
- Eskalationskultur, die Gesichtsverlust erzeugt – Mitarbeitende warten zu lange mit dem Stopp.
Checklisten-Impulse für den nächsten Schichtzyklus
Kurz und wirksam – was Sie morgen starten können:
- Schichtübergabe
- Board mit den drei L‑Feldern anlegen: Lage, Lernen, Limits.
- Übergabefenster blocken, Rollen festlegen, maximal 15 Minuten.
- AAR nach Abweichungen
- 5 Fragen ausdrucken und neben das Learning Log hängen.
- Verantwortliche für Moderation pro Schicht benennen.
- Stop-the-line
- Klare Stopp‑Kriterien je Anlage definieren und sichtbar machen.
- Neutrales Signal und Ablauf trainieren, Wertschätzung verankern.
- SBAR
- Karten/Poster bereitstellen; SBAR in Tickets und Funkregeln integrieren.
- Einmal pro Woche ein SBAR‑Beispiel im Team besprechen.
- Cross‑Training
- Drei kritischste Aufgaben definieren, Lernziele beschreiben, Freigabestufen festlegen.
- Mikro‑Trainings in den Schichtplan aufnehmen (10 Minuten).
Wertebasierte Führung macht diese Hebel dauerhaft: Sie schützt Menschen und Anlagen, beschleunigt Lernen und schafft eine Atmosphäre, in der Teams ihr Potenzial abrufen – auch unter Hochlast.
Wenn Sie diese Hebel im eigenen Umfeld strukturiert verankern möchten – vom Bewerbungstraining und Berufseinstieg über „Werde ein Leader“ bis „Verantwortung übernehmen“ – unterstütze ich Sie praxisnah mit Chemie‑ und Produktionserfahrung aus Linie, Standort und internationalen Projekten. Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Erstgespräch. Kontakt: info@young-professionals-coaching.de, Tel. +49 (0)176 227 127 67.