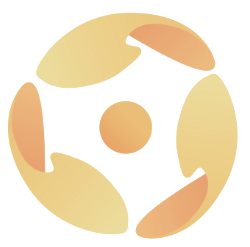Publikationen

Buch: Jobinterview Meistern – überzeuge fachlich und Emotional
Lerne, wie du dein Bewerbungs-gespräch in eine Zusage verwandelst. Hol dir mein zweites Buch bei Amazon als Taschenbuch und auch als eBook.

Buch: Überzeugend Bewerben – worauf Entscheider wirklich achten
Hol dir meine 7-Schritte-Anleitung mit wertvollen Tipps für deine Bewerb-ungsunterlagen bei Amazon als Taschenbuch oder eBook.

ein Personal
Branding Für DEIne Bewerbung
Lade dir kostenlos und direkt meine Anleitung herunter, um dein Personal Branding zu entwerfen und deine Bewerbungsunterlagen richtig aufzuwerten.

Was Entscheider wirklich hören wollen – 60‑Sekunden‑Pitch und 7 STAR‑Antworten
Entscheider in der Chemie- und Prozessindustrie hören im Interview vor allem eines: ob Sie in realen Produktionsumgebungen sicher, strukturiert und wirkungsorientiert handeln. Sie wollen konkrete Evidenz – messbare Ergebnisse, robuste Methoden (z. B. STAR, Root Cause, MOC, HAZOP), Teamfähigkeit im Schichtbetrieb und Ihre Fähigkeit, international zu arbeiten. Starten Sie deshalb mit einer prägnanten 60‑Sekunden‑Vorstellung, die Branche, Rolle, Wirkung und Werte verbindet.
Beispiel Selbstvorstellung (DE)
- Situation: „Ich bin Verfahrensingenieurin mit Praktika in der Polymersynthese und Erfahrung im 24/7‑Schichtumfeld.“
- Stärke und Methode: „Ich kombiniere Sicherheitsfokus und strukturierte Problemlösung – von MOC‑Disziplin bis 5‑Why/RCM.“
- Wirkung mit KPIs: „Im letzten Projekt haben wir die Batch‑Cycle‑Time um 12 % gesenkt und First‑Pass‑Yield von 91 % auf 97 % gesteigert.“
- Passung und Motivation: „Ich möchte in einer Umgebung arbeiten, in der Prozesssicherheit und klare Standards die Basis für skalierbare Exzellenz sind.“
Example self‑introduction (EN)
- Situation: “I’m a chemical engineer with hands‑on exposure to 24/7 polymer production and pilot‑to‑plant scale‑up.”
- Strength and method: “I lead with safety and structure – disciplined MOC, STAR storytelling, and root‑cause rigor.”
- Impact with KPIs: “We reduced batch cycle time by 12% and improved first‑pass yield from 91% to 97%.”
- Fit and motivation: “I’m looking to contribute where process safety and standard work enable reliable scale‑up.”
Tipp: Nennen Sie 2–3 relevante KPIs (z. B. TRIR/PSER, OEE, FPY, OTIF, Alarmrate/h) und einen Lerneffekt. Das sendet genau die Signale, nach denen gefragt wird: Ownership, Wirkung, Lernfähigkeit.
Die 7 Fragen – starke STAR‑Antworten mit Branchenbezug (DE/EN)
1) Sicherheit: Beinaheunfall und MOC
- Was Entscheider prüfen: Prozesssicherheitsdenken, Meldedisziplin, MOC‑Reife, Führung am Shopfloor.
- Frage (DE): „Beschreiben Sie einen Beinaheunfall und was Sie daraus abgeleitet haben – inkl. MOC.“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Bei der Inbetriebnahme einer Harzlinie fiel uns ein potenziell blockierter Entlastungsweg auf – ein Beinaheereignis.“
- Task: „Risikobewertung und nachhaltige Abstellung vor Produktionsstart.“
- Action: „Stop‑Work aktiviert, PSSR ergänzt, MOC eröffnet; Dichtungsspezifikation geändert, Checkliste für Entlastungswege in die Pre‑Startup‑Kontrolle aufgenommen; Toolbox‑Talk mit allen Schichten.“
- Result: „Null Ereignisse; MOC‑Abschluss in 14 Tagen; Audit‑Trefferquote bei PSSR um 20 % verbessert; Near‑Miss‑Rate stieg kurzfristig um 35 % (bessere Meldedisziplin). KPIs: TRIR 0, PSER Tier‑1/2 0.“
- Question (EN): “Walk me through a near miss you handled and how you used MOC to prevent recurrence.”
- STAR answer (EN):
- Situation: “During start‑up we detected a potentially blocked relief path.”
- Task: “Contain risk and prevent recurrence before ramp‑up.”
- Action: “Initiated stop‑work, added a PSSR step, raised an MOC; changed gasket spec, embedded relief‑path checks into pre‑start checklist; ran shift toolbox talks.”
- Result: “Zero incidents; MOC closed in 14 days; PSSR audit score +20%; near‑miss reporting +35%. KPIs: TRIR 0, PSER Tier 1/2 0.”
2) Abweichungsmanagement und Root Cause
- Was Entscheider prüfen: Struktur (5‑Why/Fishbone), CAPA‑Qualität, Dokumentation, Wiederholungsvermeidung.
- Frage (DE): „Erzählen Sie von einer OOS‑Abweichung und Ihrer Root‑Cause‑Herangehensweise.“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Viskosität außerhalb Spezifikation in drei Batches.“
- Task: „Schnelle Ursachenanalyse, sichere Disposition, robuste CAPA.“
- Action: „Datenreview, 5‑Why, Ishikawa; Rohstoff‑Chargenstreuung und zu niedrige Rührerdrehzahl identifiziert; Eingangsprüfung (CoA) verschärft, Rezeptgrenzen angepasst, SOPs und Training aktualisiert; Wirksamkeitskontrolle nach 8 Wochen.“
- Result: „FPY 91 % → 97 %; Wiederholrate der Abweichungen –70 %; CAPA‑Wirksamkeit bestanden; RFT in der QC +5 pp.“
- Question (EN): “Describe an out‑of‑spec event and how you drove root cause and CAPA.”
- STAR answer (EN):
- Situation: “Three consecutive batches off‑spec viscosity.”
- Task: “Find true root cause, protect customers, prevent recurrence.”
- Action: “Data review, 5‑Why, fishbone; found raw‑material variability and low agitation; tightened incoming QC, adjusted recipe limits, updated SOPs and trained shifts; verified effectiveness at 8 weeks.”
- Result: “FPY improved 91% → 97%; deviation recurrence −70%; CAPA effectiveness met; QC right‑first‑time +5pp.”
3) Scale‑up‑Fail: vom Pilot zur Anlage
- Was Entscheider prüfen: Scale‑up‑Heuristiken, HAZOP‑Reife, technische Tiefe (Mischzeit, Wärmeabfuhr).
- Frage (DE): „Ein Scale‑up ist fehlgeschlagen – was haben Sie getan und gelernt?“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Im Plant‑Trial trat ein stärkerer Exotherm auf als im Pilot – Temperaturspitzen.“
- Task: „Sichere, stabile Prozessführung herstellen.“
- Action: „Reaktionskalorimetrie nachgezogen, Dosierprofil und Tip‑Speed skaliert, Wärmetauscherleistung geprüft; HAZOP addendum, Interlocks und Alarmgrenzen angepasst; enger mit Betrieb und Instandhaltung abgestimmt.“
- Result: „Ausbeute +6 %, Batch‑Zeit –12 %, keine PSER‑Ereignisse; Lernkarte in Lessons‑Learned‑Datenbank.“
- Question (EN): “A scale‑up failed. How did you stabilize the process and what did you learn?”
- STAR answer (EN):
- Situation: “Plant trial showed higher exotherm than pilot.”
- Task: “Restore safe, capable operation.”
- Action: “Ran reaction calorimetry, adjusted feed profile and tip speed, checked heat‑transfer limits; issued HAZOP addendum, retuned interlocks/alarms; aligned closely with Ops and Maintenance.”
- Result: “Yield +6%, cycle time −12%, zero PSER; captured learning for future transfers.”
4) Schichtkommunikation und Übergaben
- Was Entscheider prüfen: Handover‑Qualität, Standardisierung (SBAR), Tier‑Meetings, Permit‑to‑Work.
- Frage (DE): „Wie sichern Sie wirksame Übergaben im Schichtbetrieb?“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Unklare Übergaben führten zu verspäteten Anfahrten.“
- Task: „Transparenz, Standard und Disziplin etablieren.“
- Action: „Tier‑1‑Huddles eingeführt, SBAR‑Handover‑Karte, Leitstand‑Whiteboard, digitale Logbücher, PTW‑Check vor Start; kurze, visuelle KPI‑Boards (Alarmrate/h, Start‑Delay‑Minuten).“
- Result: „Startverzögerungen –30 %, Alarmrate –25 %, Meldungen von Beinaheereignissen +40 % (Vertrauenskultur).“
- Question (EN): “How do you ensure robust shift handovers?”
- STAR answer (EN):
- Situation: “Inconsistent handovers delayed start‑ups.”
- Task: “Standardize and improve transparency.”
- Action: “Implemented tier‑1 huddles, SBAR cards, control‑room whiteboard and e‑logs, PTW checks; visual KPIs (alarms/hour, start‑up delay).”
- Result: “Start‑up delays −30%, alarms −25%, near‑miss reporting +40%.”
5) Internationale Zusammenarbeit
- Was Entscheider prüfen: Interkulturelle Wirksamkeit, Standardharmonisierung, Remote‑Führung.
- Frage (DE): „Beschreiben Sie eine internationale Zusammenarbeit mit Produktionsteams.“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Commissioning in einem Werk im Ausland, HQ in Deutschland.“
- Task: „Standards, Qualität und Tempo sichern – über Zeitzonen und Sprachen hinweg.“
- Action: „SOPs zweisprachig, RACI geklärt, wöchentliche Joint‑Tier‑Meetings; Pairing von Operatoren, kulturelle Briefings; gemeinsame KPI‑Definition (OTIF, Abweichungsrate, Trainingsquote).“
- Result: „OTIF 96 %, CAPA‑Durchlaufzeit –35 %, Onboarding‑Zeit –20 %; belastbare Zusammenarbeit.“
- Question (EN): “How did you deliver with international operations teams?”
- STAR answer (EN):
- Situation: “Commissioning abroad with German HQ.”
- Task: “Align standards, quality, and pace across sites.”
- Action: “Bilingual SOPs, clear RACI, weekly joint tiers; operator pairing, cultural briefings; unified KPIs (OTIF, deviation rate, training completion).”
- Result: “OTIF 96%, CAPA lead time −35%, onboarding time −20%.”
6) Frühe Führungsverantwortung ohne formale Macht
- Was Entscheider prüfen: Einfluss, Coaching‑Haltung, Teamaktivierung.
- Frage (DE): „Wann haben Sie ohne Führungsfunktion Führung übernommen?“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Unordnung im Ersatzteillager verursachte Stillstände.“
- Task: „Stabilität erhöhen, ohne Budget oder Titel.“
- Action: „5S‑Event moderiert, Kanban für Verschleißteile, Visuals im Leitstand; Operatoren eingebunden, kleine, schnelle Gewinne gefeiert.“
- Result: „OEE +3 pp, ungeplante Stillstände –18 %, Mitarbeiterzufriedenheit (Shopfloor‑Survey) +12 %.“
- Question (EN): “Tell me about leading without authority.”
- STAR answer (EN):
- Situation: “Spare‑parts chaos drove downtime.”
- Task: “Improve stability without formal authority.”
- Action: “Facilitated 5S, set up Kanban, added visual controls; engaged operators and celebrated quick wins.”
- Result: “OEE +3pp, unplanned downtime −18%, shop‑floor engagement +12%.”
7) KPIs und Priorisierung in der Produktion
- Was Entscheider prüfen: Kennzahlenkompetenz, Leading vs. Lagging, Shopfloor‑Steuerung.
- Frage (DE): „Wie messen und steuern Sie Leistung in der Chemieproduktion?“
- STAR‑Antwort (DE):
- Situation: „Resin‑Linie mit schwankender Performance.“
- Task: „KPI‑Baum aufsetzen, Fokus und Routinen schaffen.“
- Action: „Lagging: TRIR, PSER, FPY, OTIF; Leading: Alarmrate/h, MOC‑Durchlaufzeit, CAPA‑On‑Time, Training‑Completion, Batch‑Cycle‑Time. Tier‑Boards eingeführt, Ziel‑/Ist‑Abweichungen visualisiert, Pareto‑Reviews wöchentlich, Eskalationspfade definiert.“
- Result: „FPY +5 pp, Cycle‑Time –8 %, CAPA‑On‑Time 95 %, Alarmrate –22 %; stabilere Abläufe und klarere Entscheidungen.“
- Question (EN): “How do you use KPIs to drive performance?”
- STAR answer (EN):
- Situation: “Inconsistent resin‑line performance.”
- Task: “Build a KPI hierarchy and routines.”
- Action: “Lagging: TRIR, PSER, FPY, OTIF. Leading: alarms/hour, MOC cycle time, CAPA on‑time, training completion, batch cycle time. Introduced tier boards, weekly Pareto, clear escalation.”
- Result: “FPY +5pp, cycle time −8%, CAPA on‑time 95%, alarms −22%.”
Körpersprache und Präsenz in Produktionsumgebungen
- Sicherheit zuerst: Tragen Sie PSA korrekt, fragen Sie nach Site‑Regeln, beachten Sie Sperrmarkierungen und PTW‑Zonen. Das signalisiert Respekt und Process‑Safety‑Mindset.
- Stimme und Sprache: Sprechen Sie klar, etwas langsamer und strukturiert (Situation – Aufgabe – Vorgehen – Ergebnis). In lauter Umgebung kurz, prägnant, visuell denken.
- Haltung und Gestik: Gerader Stand, Schultern offen, Hände sichtbar auf Tisch oder Notizblock; präzise Gesten auf KPI‑Board oder Skizze, nicht fuchteln. Blickkontakt im Dreieck: Fragesteller – Panel – zurück.
- Visualisierung: Skizzieren Sie P&ID‑Ausschnitte oder Ablaufdiagramme, wenn es der Frage dient. Nutzen Sie einfache Zahlen (±, %, pp) statt großer Datenmengen.
- Pausen nutzen: 2–3 Sekunden denken, dann antworten. Bei Blackout: kurz zusammenfassen, eine Annahme nennen, strukturiert herleiten.
- Do’s in Leitständen: Nicht ohne Einladung an Regler greifen; Monitore nicht blockieren; Headsets/Alarmprioritäten respektieren; Handy stumm.
- Remote‑Interview: Kamera auf Augenhöhe, neutrale Beleuchtung, Beispielcharts/KPI‑Snippets griffbereit. Headset für klare Audioqualität.
Merksatz: Ruhige Souveränität, Sicherheitsbewusstsein und Zahlenkompetenz sind die Körpersprache der Produktion.
Ihre Fragen an die Hiring Manager – signalisieren Sie Reife und Passung
Stellen Sie 3–5 gezielte Fragen, die Kultur, Prioritäten und Rolle greifbar machen:
- „Wie beschreiben Sie die Reife Ihres Process‑Safety‑Managements (z. B. MOC‑Disziplin, Lessons Learned, Tier‑Struktur)?“
- „Welche drei KPIs bestimmen den Erfolg der Rolle in den ersten 6–12 Monaten? Wie wird Erfolg gemessen und gefeiert?“
- „Wie sieht das Schicht‑ und Übergabemodell aus (Ressourcentiefe, Vertretungsregeln, Overtime‑Policy)?“
- „Welche Top‑Risiken/Engpässe im nächsten Jahr (Debottlenecking, Energie, Qualität, Lieferkette) – und welche Investitionen sind geplant?“
- „Wie sind Entscheidungsrechte und Schnittstellen zu EHS, QA und Instandhaltung geklärt? Gibt es ein RACI?“
- „Welche Entwicklungsangebote gibt es für Nachwuchsführung (Mentoring, Schulungen, internationale Einsätze)?“
- Optional EN variants:
- “How mature is your PSM system (MOC discipline, learning culture, tier governance)?”
- “What are the top three KPIs for this role in the first 6–12 months?”
- “How do shift handovers and coverage work in practice?”
- “What are the key risks and investments on the 12‑month horizon?”
- “How are decision rights across EHS/QA/Maintenance defined?”
Schließen Sie kurz: „Danke für die Einblicke – ich sehe klare Anknüpfungspunkte, z. B. bei [Thema X], wo ich mit [Methode/Yield‑Hebel] schnell Wirkung erzielen kann.“
Praxisnah trainieren – damit Ihre Antworten sitzen (DE/EN)
Wenn Sie diese Antworten souverän und anschlussfähig formulieren, steigen Ihre Chancen deutlich. In unserem praxisnahen Interviewtraining für Einsteiger und Nachwuchsführungskräfte aus Chemie und Produktion üben Sie:
- passgenaue STAR‑Stories mit branchenspezifischen KPIs,
- präzise, zweisprachige Antwortmuster (DE/EN) für global agierende Unternehmen,
- Körpersprache und Präsenz für Leitstand, Shopfloor und Panel‑Interview,
- smarte Selbstvorstellung und überzeugende Fragen an Hiring Manager,
- Proben mit realen Jobprofilen, damit Ihre Unterlagen zum „Ticket ins Interview“ werden.
Kostenloses Erstgespräch: Wir klären Ihre Ziele, vermeiden typische Bewerbungsfehler und sichern Ihre Wunschposition ab. Kontakt:
- E‑Mail: info@young-professionals-coaching.de
- Tel.: +49 (0)176 227 127 67
- Website/Formular, WhatsApp und Instagram verfügbar
Young professional’s coaching – Dr. Michael Bessel – Coaching und Beratung UG (haftungsbeschränkt), Düsseldorf. Wertebasiertes, maßgeschneidertes Mentoring mit klarem Branchenfokus Chemie/Produktion und internationaler Erfahrung. Entscheider hören Ergebnisse – wir helfen Ihnen, sie präzise zu zeigen.
Führen, Wirken, Wachsen – Blog für Chemie & Produktion
Praxisnahes Know-how von Dr. Michael Bessel für Karriere und Leadership in Chemie und Verfahrenstechnik: strategische Laufbahnplanung, souveräne Kommunikation, überzeugend bewerben, Führungswerkzeuge jenseits der Gehaltserhöhung, Resilienz und wirksame Teamentwicklung – mit Einblicken aus internationaler Linien- und Standortverantwortung für Studierende, Young Professionals und Führungskräfte.
PORE‑Storyline, Datenfokus und Präsenz vom Shopfloor bis zum Vorstand
Überzeugen statt überreden heißt: Sie führen Entscheiderinnen und Entscheider systematisch zu einer tragfähigen Wahl – ohne Druck, sondern durch Klarheit. In Chemie und Produktion zählen Sicherheit, Qualität, Lieferfähigkeit, Kosten, Zeit und Compliance. Eine Präsentation ist dann gut, wenn sie entlang dieser Kriterien Entscheidungsreife herstellt.
Bewährt hat sich ein schlankes Storyline‑Gerüst: Problem – Optionen – Risiko – Entscheidung.
- Problem: Warum jetzt? Was steht technisch, wirtschaftlich und HSE‑seitig auf dem Spiel? Verdichten Sie die Lage auf eine Kernaussage mit messbarer Konsequenz (z. B. „Wärmetauscher E‑312 limitiert Kapazität um 8 %, Risiko ungeplanter Stillstände steigt“).
- Optionen: Stellen Sie 2–3 realistische Alternativen dar, immer inklusive „Nichts tun“. Jede Option in einem Satz mit Kosten, Zeit, HSE‑Auswirkung, Lieferfähigkeit.
- Risiko/Chancen: Quantifizieren und qualifizieren Sie pro Option die wesentlichen Risiken (HSE, OEE, CapEx/OpEx, Compliance, Reputation). Nutzen Sie einfache Visuals: Ampel, Heatmap, Sensitivität, Szenarien.
- Entscheidung: Sprechen Sie eine klare Empfehlung aus („Wir empfehlen Option B“), benennen Sie Voraussetzungen, Restunsicherheiten und die nächsten Schritte.
Beispiel Anlagenprojekt (Debottlenecking):
- Problem: Produkt X verfehlt Q3‑Bedarf um 12 % wegen Engpass am Reaktor R‑204; drei Minor‑Trips im letzten Monat.
- Optionen: 1) Nichts tun: keine Investition, aber fortgesetzte Lieferrisiken. 2) Düsenaustausch und Rührwerksmodifikation im nächsten Turnaround (+250 k€, +3 Tage Kritischer Pfad). 3) Parallel‑Reaktor mieten (Skid) als Brücke bis Major‑Shutdown (+600 k€, 8 Wochen Lieferzeit).
- Risiken:
- HSE: Option 2 erfordert Heißarbeiten im TA (mit bewährten Kontrollen), Option 3 zusätzlicher Anschluss, ATEX‑Bewertung.
- OEE/Servicegrad: Option 2 stabilisiert dauerhaft, Option 3 überbrückt Nachfragepeaks, Option 1 erhöht Backorder‑Risiko.
- Entscheidung: Empfehlung Option 2; Begründung: beste ALARP‑Balance, geringste TCO. Voraussetzungen: Lieferfreigabe bis 15.10., Engineering‑Freigabe, Betriebsrat/Schichtplanung involvieren.
Gleiche Logik funktioniert im Vorstand wie am Shopfloor – Unterschiede liegen im Zoom‑Level. Im Steering Committee führen Sie mit der Empfehlung und zwei wesentlichen Treibern. Auf der Fläche erläutern Sie Umsetzung, Schnittstellen und Arbeitssicherheit konkreter.
Daten in Botschaften verdichten und Einwände souverän behandeln
Entscheider hören zuerst das „So‑what“. Arbeiten Sie mit der Pyramidenstruktur: Kernaussage – drei Belege – Details. Jede Folie trägt eine Botschaftsüberschrift in Verbform („Option B stabilisiert Durchsatz um 10–12 % bei akzeptablem HSE‑Profil“). Visualisieren Sie Trends und Schwellen statt Rohdatenfluten:
- Zeitreihen mit Zielbändern (SPC, Cap‑Trends) statt nur Durchschnittswerten.
- Szenario‑Vergleich (Best/Base/Worst) mit Sensitivität der 2–3 stärksten Treiber.
- Risikoheatmap pro Option mit klarer Bewertungslogik (z. B. Unternehmensstandard, LOPA‑Ergebnis abstrahiert).
Praxis Turnaround:
- Verdichten Sie die Kritische‑Pfad‑Auswirkung neuer Scopes auf eine Seite: Was verschiebt sich? Welche Abhängigkeiten? Welche HSE‑Konsequenzen? Nutzen Sie S‑Kurven und ein einfaches RAG‑Schema.
- Setzen Sie „Scope Freeze + Change Control“ als Leitlinie und zeigen Sie pro zusätzlichem Job den Nettonutzen gegenüber Termindruck und Ressourcenbindung. Eine prägnante Formulierung: „Wir schlagen vor, Job 4711 zu deferrieren: +0 Tage Kritischer Pfad statt +2; HSE‑Risiko bleibt kontrolliert, da temporäre Barriere X geprüft.“
Einwände souverän behandeln gelingt mit einer 4‑Schritt‑Routine: 1) Anerkennen: „Danke für den Punkt, die Opex‑Last ist relevant.“ 2) Präzisieren: „Bezieht sich Ihre Sorge auf die Energiekosten oder auf die Wartungszyklen?“ 3) Einordnen/Brücken: „Lassen Sie uns das im Optionsvergleich verorten: Bei B liegen die Energiekosten +3 %, Wartung −15 % vs. A.“ 4) Beantworten/Absichern: „Unter Standard‑Last bleibt die Marge neutral; bei Peak‑Preisen greifen wir mit Maßnahme Y ein. Ich ergänze die Sensitivität im Anhang.“
Weitere Techniken:
- Steelmanning: Formulieren Sie den stärksten Einwand selbst („Wenn wir B wählen, verlängert sich der TA‑Pfad um 3 Tage – darum sichern wir kritische Gewerke vorab ab“).
- Vorab‑Abgleich („Pre‑Wiring“): Klären Sie Schlüsseleinwände in kurzen 1:1‑Gesprächen vor dem Decision‑Meeting. So wird die Sitzung zur Bestätigung statt zur Frühphase der Meinungsbildung.
- Entscheidungslogik explizit machen: Legen Sie Gewichtungen offen (z. B. HSE > Lieferfähigkeit > Kosten), um nicht in Zahlendebatten zu versinken, die am Ziel vorbeiführen.
HSE‑Entscheidungspraxis:
- Wenn eine kurzfristige Reparatur diskutiert wird, rahmen Sie die Argumentation mit anerkannten Kriterien (z. B. ALARP, Barrierenstatus, regulatorische Anforderungen) und zeigen Sie je Option die Restgefahr auf Managementebene, ohne in operative Anweisungen abzurutschen.
- Beispiel: „Option B reduziert die Leckagerate um >90 % mit temporären Barrieren; Restgefahr bleibt gelb, final grün nach TA‑Job 23–17. Empfehlung B mit täglichem Review.“
Präsenz und Körpersprache – vom Shopfloor bis zum Vorstand, auch hybrid
Präsenz ist die nonverbale Verstärkerstufe Ihrer Struktur. In technischen Kontexten überzeugen ruhige Autorität, Klarheit und Sicherheit im Auftreten.
Vor Ort (Shopfloor, Leitwarte):
- Standfest, Schulterlinie offen, Hände sichtbar. Nutzen Sie einen ruhigen Gestik‑Korridor auf Bauchhöhe; Zeigegesten begrenzen.
- Sprechen Sie in kurzen, vollständigen Sätzen und übersetzen Sie Fachbegriffe, sobald Führungskräfte anderer Funktionen anwesend sind.
- Sicherheit hat Vorrang: Demonstrieren Sie Vorbildverhalten (PPE, Zonenregeln). Das schafft Glaubwürdigkeit, bevor Sie das erste Wort sagen.
Vorstand/Steering Committee:
- Starten Sie mit Empfehlung und Risiko‑Abwägung in 60–90 Sekunden („Executive Summary“), dann Details auf Abruf.
- Nutzen Sie Pausen gezielt: Nach der Kernaussage 2–3 Sekunden Stille geben, damit die Botschaft wirkt.
- Sitzordnung und Blickführung: Positionieren Sie sich so, dass Sie die Entscheiderachse frontal ansprechen; sprechen Sie bewusst Personen aus Schlüsselfunktionen an („Für Finance: CapEx 250 k€, TCO neutral in 18 Monaten“).
Hybrid/Remote:
- Kamera auf Augenhöhe, Licht frontal, Ton priorisieren (Headset). Blick in die Linse bei Kernaussagen.
- Visuals „remote‑tauglich“: große Schriften, wenig Text, klare Farbkontraste, maximal eine Kernaussage je Folie.
- Interaktion steuern: Benennen Sie eine Person für Chat/Handzeichen, bauen Sie Mikro‑Checks ein („Stimme ich 1/0?“), nutzen Sie kurze Polls für Richtungsentscheide.
- In internationalen Teams sprechen Sie 10–15 % langsamer, vermeiden idiomatische Formulierungen und prüfen Verständnis mit offenen Fragen („Welche Risiken sehen Sie in Ihrem Marktumfeld?“).
Eine einfache Faustregel: 3–20–200. In 3 Sekunden muss Ihre Kernbotschaft verständlich sein (Slide‑Titel). In 20 Sekunden folgt die Begründung (Grafik + Zahl). In 200 Sekunden liefern Sie die wesentlichen Details und Optionen.
Meeting‑Design und Stakeholder‑Management über Hierarchie‑ und Kulturgrenzen
Gute Argumente brauchen ein gutes Entscheidungsformat. Designen Sie Meetings konsequent entscheidungsorientiert.
Vorbereitung:
- Ziel klären: „Welche Entscheidung soll am Ende stehen?“
- Pre‑Read 24–48 Stunden vorher verschicken: eine Seite Executive Summary, maximal zehn Seiten Anhang mit Daten/Methodik.
- Rollen festlegen: Entscheider, Sponsor, Presenter, Zeitwächter, Protokoll. Definieren Sie den Quorum‑Check zu Beginn.
- Entscheidungslog: Halten Sie Festlegungen, Voraussetzungen und To‑dos in einem zentralen Log fest und referenzieren Sie es in Folge‑Terminen.
Durchführung:
- Einstieg mit Zweck, Entscheidung, Zeitrahmen. Vereinbaren Sie eine Parking‑Lot‑Spalte für Themen außerhalb des Entscheidungsfokus.
- Zeitboxen je Agenda‑Punkt; Unterbrechungen steuern und auf die Struktur verweisen („Zu diesem Risiko kommen wir in 3 Minuten auf Folie 8“).
- Beschlüsse in der Sitzung formulieren lassen („Wir beschließen Option B unter den Bedingungen X/Y, Review am…“).
Stakeholder‑Management:
- Stakeholder‑Karte erstellen (Einfluss/Interesse) und kulturelle Faktoren berücksichtigen: In stärker hierarchischen Kulturen gewinnen 1:1‑Vorgespräche („Pre‑Alignment“) besondere Bedeutung; in konsensorientierten Teams brauchen Sie mehr Vorlauf für Feedbackschleifen.
- Über Schichten hinweg arbeiten: Nutzen Sie Visual Management (A3, KPIs am Board), Schicht‑Handover‑Formate und kurze Stand‑ups, damit Entscheidungen den Betrieb tatsächlich erreichen.
- Funktionsübergreifend denken: EHS, Instandhaltung, Produktion, Supply Chain, Procurement, Qualität, Finance – benennen Sie Schnittstellen und Verantwortlichkeiten (RACI) pro Option.
- Betriebsrat und Behördenbezug früh adressieren, wenn Maßnahmen Auswirkungen auf Arbeitsorganisation oder Genehmigungen haben. Das verhindert späte Eskalationen.
Beispiel Turnaround‑Entscheidung:
- Sie stehen vor der Frage, einen zusätzlichen Inspektionsumfang ins Scope zu ziehen. Pre‑Read enthält: Entscheidungsfrage, drei Optionen (inkl. Defer), CP‑Auswirkung, HSE‑Risiken mit Barrierenstatus, Kosten/Synergien.
- Vorabgespräche: Instandhaltung (Ressourcen), EHS (Barrieren), Planung (CP), Finance (Budget).
- Sitzung: Empfehlung B (gezielter Umfang), Begründung mit Risiko‑Heatmap und TCO, fixierter Beschluss, Entscheidungslog, Kommunikationsplan in die Schichten.
Beispiel HSE‑Managemententscheidung:
- Thema: Temporäre Maßnahme bis zum nächsten TA. Sie rahmen die Diskussion mit Unternehmensstandard (z. B. ALARP, Life‑Saving‑Rules) und zeigen transparent, was die Maßnahme leistet und was nicht. Entscheidungsempfehlung beinhaltet tägliche Wirksamkeitskontrollen, klare Abbruchkriterien und Verantwortlichkeiten – argumentiert auf Management‑, nicht auf Arbeitsanweisungsebene.
Zum Schluss der Praxis‑Impuls: Üben Sie Ihre PORE‑Storyline an einem realen Fall (Anlage, TA, HSE). Schreiben Sie eine einseitige Executive Summary mit klarer Empfehlung, zwei stärksten Treibern, Optionenvergleich in einem Mini‑Tableau und den nächsten drei Schritten. Halten Sie einen 3‑Minuten‑Pitch, holen Sie sich Feedback aus Produktion, EHS und Finance und justieren Sie Ihre Visuals. Diese Schleife macht aus guter Argumentation überzeugende Entscheidungen – auf Shopfloor und Vorstandsebene gleichermaßen.
Leadership & Karriere in Chemie und Produktion – Blog von Dr. Michael Bessel
Praxisnahe Impulse und Tools für Studierende, Berufseinsteiger und Führungskräfte der Chemie/Verfahrenstechnik: strategische Karriereplanung, souveräne Kommunikation und Präsenz, strukturierte Argumentation und Präsentation, bewusste Körpersprache, Resilienz sowie wirksame Teamentwicklung. Insights aus 14+ Jahren Linien- und Standortverantwortung (Forschung, Expat, Projektführung), Bewerbungs- und Interviewtraining für den Berufseinstieg sowie Programme Werde ein Leader und Verantwortung übernehmen. Werteorientiert, individuell, international – mit Downloads, Beispielen aus der Praxis und aktuellen Kundenstimmen. Inhalte auf Deutsch und Englisch.
Beiträge nach Monat
2025
Präsenz im Werk: Was zählt hinter Helm, Brille und Maske
In Anlagen, Labor und Leitstand sind Helm, Schutzbrille, Maske, Gehörschutz und Handschuhe Pflicht – und gleichzeitig verdecken sie viele gewohnte nonverbale Signale. Was weiterhin glasklar sichtbar bleibt, sind Ihre Haltung, Ihre räumliche Positionierung, Ihre Stimme, Ihr Blick und die Art, wie Sie mit dem Team interagieren. Entscheider und Teams achten dabei auf drei Dinge:
- Sicherheit: Tragen und nutzen Sie PSA selbstverständlich und vorbildlich. Ihre Präsenz ist sicherheitsorientiert, wenn Sie Ruhe ausstrahlen, klare Handzeichen geben, Distanzzonen respektieren und Abläufe ohne Hektik gestalten. Sicherheit wirkt – als Kompetenzsignal und als Vertrauensanker.
- Kompetenz: In Lärm, Schichtstress und unter Zeitdruck zeigt sich Fachlichkeit durch strukturiertes Vorgehen, präzise Sprache, funktionale Gestik und zielgerichtete Blickführung, z. B. am DCS (Distributed Control System). Kompetent wirkt, wer Sachverhalte kurz, korrekt und nachvollziehbar ordnet und Entscheidungen begründet.
- Teamorientierung: Präsenz ist nie Selbstdarstellung um ihrer selbst willen. Sie ist dienende Führung: Sie geben Orientierung, machen Beiträge anderer sichtbar, hören aktiv zu und halten den Raum – auch, wenn es laut, eng oder hektisch ist.
Diese Prinzipien übersetzen wir im Folgenden in praktikable Werkzeuge für fünf typische Situationen in Chemie und Verfahrenstechnik – plus Mikro‑Techniken, Do’s & Don’ts und eine 60‑Sekunden‑Übung, die Sie im Alltag trainieren können.
Fünf Kernsituationen – so wirken Sie souverän trotz PSA, Lärm und Schichtstress
1) Schichtübergabe
- Stand und Raumposition: Stellen Sie sich seitlich versetzt (45°) zum Gegenüber, mit freiem Blick auf Board/DCS. Stabiler, hüftbreiter Stand, beide Füße geerdet; Werkzeug/Tablet so halten, dass Ihre Hände sichtbar bleiben. Halten Sie 1–1,5 m Abstand; in engen Räumen eher diagonale Position als frontal.
- Stimme im Lärm: Sprechen Sie langsamer und tiefer, statt lauter. Nutzen Sie kurze Sinnabschnitte (ein Gedanke – ein Atemzug). Wiederholen Sie kritische Werte. Nutzen Sie Headsets, falls verfügbar, und bestätigen Sie aktiv: „Bestätigen Sie bitte die 68 °C am Reaktor 2.“
- Blickführung am DCS: Erst Übersicht (Mimic), dann Alarm/Events, dann Trends, dann Detail (Faceplates). Benennen Sie, wohin Sie schauen: „Ich schaue auf die Trendkurve von R2 – Temperatur stabil in den letzten 30 Minuten.“
- Gestik über PSA: Offene Handflächen auf Brusthöhe, Finger zusammen, Zeigegesten als „offene Hand“ statt ausgestrecktem Finger. Kurze, ruhige Bewegungen, kein Fuchteln.
- Abschlussstruktur: 3‑Punkte‑Schluss (Status – Risiko – Nächster Schritt) plus „Readback“: „Status: R2 im Soll; Risiko: Wärmetauscher 2 war grenzwertig; Nächster Schritt: Spülung 14:00 Uhr. Haben Sie das so?“
2) Shopfloor‑/Gemba‑Walk
- Raumführung: Gehen Sie im „Dreieck“ – Beobachtungspunkt (Sicht auf Kennzahlen/Visual Management), Gesprächspunkt (seitlich versetzt zum Mitarbeitenden), Entscheidpunkt (Tafel/Andon). Halten Sie ausreichend Abstand zu heißen/rotierenden Teilen; Positionieren Sie sich nie zwischen Mitarbeitenden und Fluchtweg.
- Körperausdruck: Aufrecht, Schultern locker, Hände sichtbar. Zeigen Sie mit offener Hand auf Abweichungen. Knie leicht entspannt; keine dominante „breitbeinige“ Pose in engen Gängen.
- Stimme im Lärm: Nutzen Sie vereinbarte Handzeichen (Stop, Langsamer, Ok?), ergänzen Sie kurze, klare Sätze. Vermeiden Sie „OK‑Zeichen“ mit Finger‑Ring – kulturell missverständlich; nutzen Sie stattdessen Daumen hoch oder flache Hand seitlich als „Gut“ (vorher teamweit klären).
- Teamorientierung: Fragen zuerst, werten später: „Was sehen Sie hier?“ – „Was ist heute Ihr Engpass?“ Achten Sie auf „Zuhör‑Nicken“ und Blickkontakt trotz Brille/Maske: Stirn und Augenbrauen leicht offen, Kopfneigung als Signal.
- Safety‑Signal: Gehen Sie an Gefahrenstellen bewusst langsamer, blicken Sie kurz zu Markierungen/Absperrungen und zeigen Sie diese sichtbar – das ist gelebte Sicherheit und wirkt.
3) HAZOP/Meeting
- Präsenz am Tisch: Sitzen Sie leicht seitlich zur Gruppe, Oberkörper aufgerichtet, Unterarme locker sichtbar auf dem Tisch. Legen Sie Maske/Brille so an, dass Ihre Stimme nicht gedämpft wird (gerader, offener Kopf‑Hals‑Winkel).
- Strukturierte Argumentation: Nutzen Sie eine kurze, wiederkehrende Struktur: Beobachtung – Bewertung – Empfehlung. Beispiel: „In Node 3 sehen wir eine mögliche Blockade. Bewertung: Folgen bis 6 bar Überdruck. Empfehlung: Rückschlagventil plus Interlock XY.“
- Blick und Gestik: Blick in Dreiecksbewegung zwischen Moderator, P&ID und Team. Gestik auf Brusthöhe, Handflächen offen. Zeigehilfen (Laser/Pointer) ruhig führen, nicht kreiseln lassen.
- Moderations‑Mikrotechnik: „Parkplatzphrase“ für Themen, die abdriften („Ich parke das – wir kommen nach Node 5 darauf zurück“). Benennen Sie Zustimmung hörbar („verstanden“, „nachvollziehbar“), ohne sofort zu bewerten.
- Entscheidungsabschluss: Fassen Sie messbar zusammen: „Wir dokumentieren Maßnahme M‑12, Owner Produktion, Termin 30.10., Risiko nach Implementierung: niedrig.“
4) Audit/Begehung
- Erste Minute: Ruhig atmen, klar begrüßen, Namen und Rolle nennen. Kein Händedruck in Bereichen, wo PSA/Hygiene im Fokus steht – stattdessen verbale, klare Begrüßung mit kurzem Nicken.
- Wegführung: Gehen Sie halbe Schrittlänge voraus, Blickrichtung dorthin, wohin Sie als Nächstes führen. Bleiben Sie an Stop‑Punkten so stehen, dass Auditor:in, Exponat und Fluchtweg in einer Linie liegen.
- Zeigen statt rechtfertigen: Öffnen Sie, wenn möglich, Sichtfenster/Displays; verwenden Sie klare Handzeichen, um Fluss/Status zu markieren. Vermeiden Sie bei Fragen lange Monologe. Struktur: Frage wiederholen – Befund zeigen – Maßnahme nennen.
- Stimme: Kurze Sätze, aktive Verben, Zahlen/Normen korrekt und knapp. Wenn Sie etwas nachschlagen: ankündigen, schauen, zurückmelden. Das wirkt zuverlässig, nicht unsicher.
- Teamorientierung: Binden Sie Kolleg:innen aktiv ein: „Herr X verantwortet den Kalibrierprozess – bitte zeigen Sie Schritt 3.“ Damit zeigen Sie Vertrauen und Führung.
5) Interview/Assessment im Werk oder Leitstand
- Auftritt unter PSA: Saubere, korrekte PSA, Namensschild sichtbar. Aufrechter Stand, Füße geerdet. Keine Hände in den Taschen; Unterlagen so, dass Sie frei gestikulieren können.
- Blickführung am DCS: Wenn Cases am Leitstand besprochen werden, führen Sie den Blick sichtbar: Übersicht – Alarme – Trends – Maßnahmen. Sprechen Sie mit, wohin Ihr Blick geht („Ich prüfe die Alarmhistorie der letzten 2 h – keine Kritikalitäten“).
- Stimme und Inhalt: STAR‑Struktur (Situation – Task – Action – Result) für Antworten, in ruhiger, tiefer Stimme. Pausen nutzen; in lauter Umgebung lieber wiederholen als lauter werden.
- Teamorientierung zeigen: Anerkennen Sie Leistung anderer („Wir haben als Schichtteam…“), benennen Sie Ihren Anteil präzise, ohne sich zu überhöhen. Fragen Sie aktiv zurück („Welche Erwartungen haben Sie an die ersten 90 Tage in dieser Rolle?“).
Mikro‑Techniken, die immer wirken: Stand, Raum, Gestik, Stimme, Blick, Handzeichen, Kultur
- Stand und Raumposition:
- Hüftbreiter, stabiler Stand, Gewicht mittig. Schuhspitzen leicht nach außen – wirkt offen.
- 45°‑Winkel statt Frontalkonfrontation, vor allem in engen Räumen und bei Hierarchiegefälle.
- Respektieren Sie Distanzzonen: im deutschsprachigen Raum 1–1,5 m als neutraler Arbeitsabstand. International variabel: in Teilen Asiens geringer, in Teilen Nordeuropas größer. Grundregel: beobachten, spiegeln, bei Unsicherheit Abstand vergrößern.
- Gestik über PSA:
- Offene, kompakte Gesten auf Brusthöhe. Handflächen sichtbar. Finger zusammen – vermeidet hektischen Eindruck.
- Vermeiden Sie Zeigefinger‑Dominanz; nutzen Sie „offene Hand“ zum Verweisen.
- Taschen, Klemmbretter, Tablets so halten, dass Arme nicht eine „Barriere“ bilden.
- Stimme im Lärm:
- Tempo reduzieren, Tonhöhe leicht senken, deutlicher artikulieren. Kurze Sätze.
- „1‑Atemzug‑Regel“: ein Gedanke pro Atemzug. Dadurch bleiben Sie verständlich.
- In lauter Umgebung ankündigen: „Kurzer Punkt“ – sprechen – „Rückfrage?“
- Blickführung am DCS:
- Fixe Reihenfolge trainieren: Übersicht – Alarme – Trends – Details – Bestätigung.
- Blickanker nutzen: nach jedem Satz kurz zum Gegenüber schauen, dann zurück auf die Anzeige.
- Benennen Sie, was Sie sehen, bevor Sie bewerten („Trend zeigt +3 K/h“ statt „zu schnell“).
- Klare Handzeichen:
- Teamweit vereinbaren: Stop (flache Hand), Langsamer (Handfläche abwärts, ruhige Auf‑Ab‑Bewegung), Gut/verstanden (Daumen hoch); keine kulturell heiklen Zeichen (z. B. „OK‑Ring“).
- Zeichen immer mit Blick und kurzem Wort koppeln („Stop“ + Blick + Hand) – dreifache Redundanz verbessert Sicherheit und Wirkung.
- Kulturelle Distanzzonen im internationalen Umfeld:
- Nähe/Distanz, Blickkontakt und Lautstärke variieren kulturell. Leitlinie: Erst beobachten, dann behutsam synchronisieren, bei formalen Anlässen eher konservativ.
- Rang spürbar machen, nicht ausspielen: Sie geben Orientierung, ohne zu bedrängen. Platzieren Sie sich so, dass alle sich sicher fühlen (z. B. nicht „den Ausgang zustellen“).
Do’s & Don’ts für Nachwuchsführungskräfte – plus 60‑Sekunden‑Übung für vertrauensbildende Präsenz
- Do’s:
- Sicherheit sichtbar machen: PSA vorbildlich, Wege prüfen, Handzeichen nutzen, Tempo an die Umgebung anpassen.
- Struktur geben: Kurze Zusammenfassungen, klare nächste Schritte, bestätigte Verständigung (Readback).
- Team stärken: Beiträge würdigen, offene Fragen stellen, Verantwortung delegieren und sichtbar lassen.
- Ruhe kultivieren: Atmen, Pausen setzen, Blick führen, Sprechtempo senken.
- Werte zeigen: Respekt, Klarheit, Verantwortung – explizit benennen, wenn Sie entscheiden.
- Don’ts:
- Verschlossene Wirkung: Arme verschränken, Körper abwenden, Tablet als „Schutzschild“ halten.
- Überdominanz: In engen Räumen „groß machen“, zu nah herantreten, unterbrechen, zeigen mit Zeigefinger.
- Hektik statt Präsenz: Hastige Gesten, schnelle Richtungswechsel, Sprechdurchlauf ohne Pausen.
- Mehrdeutige Zeichen: „OK‑Ring“, Schulterzucken als Antwort, nonverbale Ironie (Augenrollen).
- Sicherheitsrituale überspringen: „Nur kurz“ ohne Handschuh/Brille – unterminiert sofort Ihre Glaubwürdigkeit.
- 60‑Sekunden‑Übung: Werteklarheit + Körperanker
- Ankommen (10 s): Füße spüren, Knie lösen, Schultern sinken lassen. Ein- und ausatmen, jeweils 4 Sekunden.
- Wertefokus (10 s): Leise benennen: „Sicherheit – Respekt – Klarheit“. Wählen Sie heute einen Schwerpunkt.
- Haltung setzen (15 s): Hüftbreiter Stand, Brustbein sanft anheben, Nacken lang. Hände auf Brusthöhe, offen.
- Blick und Stimme (15 s): Blickdreieck trainieren (Gesprächspartner – Anzeige – Umgebung). Sagen Sie einen Satz in ruhigem, tiefem Ton: „Ich gebe kurz die drei Punkte und frage dann nach Rückmeldung.“
- Intentionsschritt (10 s): Definieren Sie den nächsten konkreten Schritt: „Ich starte mit Status, nenne Risiko, dann Maßnahme.“
Wiederholen Sie die Übung vor Schichtübergabe, Meeting oder Begehung. Sie verankern damit Ihre werteorientierte, vertrauensbildende Präsenz – sichtbar, auch mit Helm, Brille und Maske.
Wenn Sie diese Kompetenzen gezielt ausbauen wollen, profitieren Sie von branchennahem Mentoring mit Fokus Chemie/Produktion – von Schichtübergabe über HAZOP bis Audit und Interview. Young professional’s coaching unterstützt Sie mit praxisnahen Übungen, direktem Feedback und Programmen für Job‑Einsteiger:innen („Ticket ins Interview“) sowie angehende Führungskräfte („Werde ein Leader“, „Verantwortung übernehmen“). Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch, um typische Fehler zu vermeiden und Ihre Präsenz auf das nächste Level zu bringen: info@young-professionals-coaching.de, Tel. +49 (0)176 227 127 67 oder per WhatsApp/Instagram über die Website.
Prinzipienbasierte Führung in Chemie & Produktion
Berichten zufolge prallen in einem kommenden Superheldenfilm zwei etablierte Heldenteams aufeinander. Nicht aus simpler Rivalität, sondern weil eine Multiversums-Krise die Regeln außer Kraft setzt: Parallelwelten beginnen zu kollidieren, ein Antagonist stößt eine Kettenreaktion an, und jedes Team versucht, die eigene Realität zu retten. Als Konzept werden „Inkursionen“ diskutiert – Szenarien, in denen die Rettung eines Universums nur auf Kosten eines anderen möglich scheint. Ob die Details so eintreten, ist offen. Der spannende Kern ist jedoch unabhängig vom endgültigen Plot: Hochleistungs-Teams mit unterschiedlichen Zielen, Werten und Informationslagen treffen in einer Ausnahmesituation aufeinander. Kooperation wäre möglich, Konflikt erscheint kurzfristig rational.
Genau diese Konstellation ist nicht auf fiktionale Universen beschränkt. Sie ist eine vertraute Management-Realität in Chemie und Produktion: Standort A optimiert seine Kennzahlen, während Standort B unter Materialknappheit leidet; die Nachtschicht löst Probleme, deren Nebenwirkungen die Frühschicht spürt; das lokale Projektziel widerspricht der globalen Lieferpriorität. Unter Zeitdruck, mit fragmentierten Informationen und kulturellen Unterschieden eskalieren Spannungen. Führung entscheidet dann darüber, ob die Organisation in Nullsummen-Muster fällt – oder ob sie eine belastbare Allianz schmiedet, die das Gesamtsystem schützt.
Die Lehre aus dem Superhelden-Konflikt ist damit keine Dramaturgie, sondern ein Führungsprinzip: Wer Werte, Struktur und Kommunikation in den Vordergrund stellt, macht Kooperation auch in maximaler Unsicherheit rational und wirksam.
Übertragung auf Chemie & Produktion: typische Konstellationen und Muster
Die Parallelen zur operativen Praxis sind klar erkennbar:
- Standort-, Schicht- und Funktionskonflikte: In der Chemieproduktion treffen Instandhaltung, Produktion, Qualität und Supply Chain mit jeweils legitimen Zielen aufeinander. Ohne gemeinsame Leitplanken optimieren Teams lokal – oft auf Kosten des Gesamtnutzens.
- Krisen der Lieferkette: Engpässe bei Rohstoffen, Schwankungen in der Energieversorgung oder Hafenstaus erzeugen Zwangslagen. Was für eine Linie kurzfristig sinnvoll ist, gefährdet möglicherweise die Liefertreue gegenüber Schlüsselkunden.
- Internationale Projekte und Expat-Kontexte: Unterschiedliche Erwartungshorizonte, Hierarchie-Distanzen und Kommunikationsstile verstärken Missverständnisse. Was als „klare Ansage“ gemeint ist, kann andernorts als Gesichtsverlust erlebt werden.
- Zeitdruck und unvollständige Informationen: Entscheidungen müssen getroffen werden, bevor Daten vollständig vorliegen. „Richtig“ ist in der Rückschau messbar – im Moment bedeutet es, nachvollziehbar, wertebasiert und iterativ zu handeln.
In all diesen Situationen hilft Führung, das Spielfeld neu zu definieren: weg von „Wer setzt sich durch?“ hin zu „Wie schützen wir das System, das uns alle trägt?“. Das beginnt bei Prinzipien und setzt sich fort mit Strukturen, Entscheidungsmechaniken und Kommunikationsstandards.
Was Führung jetzt konkret tun muss
- Prinzipien vor Taktik setzen:
- Sicherheits-, Umwelt- und Ethikprinzipien explizit als unverrückbare Leitplanken festlegen.
- Diese Prinzipien zuerst kommunizieren, dann Ziele und Maßnahmen ableiten.
- Wirkung: Nullsummen-Denken verliert Attraktivität, weil „schnelle Siege“ ohne Prinzipientreue nicht verhandelbar sind.
- Gemeinsames Lagebild schaffen:
- Risiken, Abhängigkeiten und Zielkonflikte visualisieren (z. B. Heatmap, Abhängigkeits-Graph).
- Sichtbarkeit über alle Schichten hinweg herstellen: tägliche Kurz-Updates, visuelle Boards, digitale Dashboards.
- Wirkung: Ein gemeinsamer „Film“, nicht nur unterschiedliche „Szenen“; Informiertheit ersetzt Vermutungen.
- Rollen und Strukturen klären:
- Incident-Lead benennen, Schnittstellen-Owner bestimmen, Eskalationspfade und Entscheidungsfristen definieren.
- Einen „War-Room“ (physisch oder virtuell) einrichten, in dem Entscheidungsrechte eindeutig sind.
- Wirkung: Keine Parallelentscheidungen, weniger Reibungsverluste, höhere Entscheidungsqualität.
- Entscheidungsdesign unter Unsicherheit etablieren:
- Pre-Mortem durchführen: „Stellen wir uns vor, die Maßnahme ist gescheitert – warum?“
- OODA-Loop nutzen (Observe–Orient–Decide–Act): kurze Zyklen, schnelle Lernschleifen.
- Entscheidungslogbuch führen: Annahmen, Datenstand, Alternativen, Entscheidung, Verantwortliche.
- „No-Regret“-Maßnahmen zuerst umsetzen; Annahmen klar kennzeichnen und regelmäßig challengen.
- Wirkung: Nachvollziehbarkeit und Lernfähigkeit statt „Bauchgefühl gegen Bauchgefühl“.
- Konflikte deeskalieren und produktiv machen:
- Aktives Zuhören, Ich-Botschaften, rekapitulierende Zusammenfassungen, saubere Körpersprache (offen, ruhig, zugewandt).
- Gemeinsame „Rules of Engagement“ für Meinungsunterschiede: ausreden lassen, Zahlen und Quellen nennen, Kritik am Prozess statt an Personen.
- Wirkung: Emotionale Temperatur sinkt, Sacharbeit wird wieder möglich.
- KPI-Ausrichtung systemisch gestalten:
- Weg von lokalen Optima (z. B. maximaler Linienausstoß) hin zu System-Kennzahlen: Sicherheit, Liefertreue, Gesamtanlageneffektivität (OEE), First-Pass-Quality, CO₂-Intensität pro Auftrag.
- Bonus- und Anerkennungsmechanismen mit diesen System-KPIs verknüpfen.
- Wirkung: Allianzen werden rational, weil sie sich auszahlen.
- Kommunikation über Ebenen und Kulturen:
- Einfach, häufig, konsistent kommunizieren; in Schichtübergaben ritualisieren.
- Internationale Nuancen berücksichtigen (Direktheitsgrad, Hierarchie-Distanz, Umgang mit Fehlern).
- Wirkung: Missverständnisse werden vor der Eskalation sichtbar; Vertrauen wächst.
- Resilienz und Teamschutz sichern:
- Rotationen und Pausen planen, psychologische Sicherheit aktiv fördern.
- Fehler als Lernquellen behandeln: After-Action-Reviews (AAR) verpflichtend nach jeder kritischen Phase; Erkenntnisse sofort in Standards überführen.
- Wirkung: Leistung wird nachhaltig; Erschöpfung, Zynismus und Fluktuation sinken.
Die Kombination dieser Bausteine schafft den Rahmen, in dem starke, eigenständige Einheiten freiwillig kooperieren, weil die Organisation ihnen Orientierung, Struktur und faire Spielregeln bietet. Genau wie im Superhelden-Szenario entsteht die Option auf eine Allianz – nicht durch Appelle, sondern durch Design.
Für Nachwuchsführungskräfte und Berufseinsteiger:innen: So machen Sie es im Interview greifbar
Entscheider achten weniger auf heldenhafte Einzelleistungen als auf Teamorientierung, Transparenz, Verantwortungsübernahme und emotional anschlussfähige Kommunikation. Nutzen Sie die STAR-Logik, um abteilungsübergreifende Zielkonflikte sichtbar kompetent zu lösen:
- Situation:
- Während eines sechsmonatigen Praxisprojekts in der Polymerproduktion traten nach einer Rohstoffverknappung Zielkonflikte zwischen Produktion (Durchsatz), Qualität (Spezifikationssicherheit) und Supply Chain (Liefertreue für A-Kunden) auf. Die OEE drohte zu sinken, während Reklamationsrisiken stiegen.
- Aufgabe:
- Sie wurden gebeten, eine Entscheidungsvorlage für das Werkskomitee zu erstellen, die kurzfristige Maßnahmen möglich macht, ohne Sicherheits- oder Compliance-Prinzipien zu verletzen.
- Vorgehen:
- Prinzipien klären: Gemeinsam mit HSE und Compliance wurden unverrückbare Leitplanken festgeschrieben (Sicherheits- und Umweltstandards nicht antastbar; Spezifikationsabweichungen nur innerhalb definierter statistischer Bandbreiten).
- Stakeholder bündeln: Ein cross-funktionales Taskforce-Meeting aufgesetzt (Produktion, Qualität, Supply Chain, Instandhaltung, Vertrieb) und ein gemeinsames Lagebild erarbeitet (Heatmap der Risiken, Abhängigkeits-Graph für kritische Aufträge).
- Entscheidungsmechanik etablieren: OODA-Loop in 48-Stunden-Zyklen; Pre-Mortem für die Top-Optionen; Entscheidungslogbuch inkl. Annahmen. Ein Incident-Lead wurde benannt; Eskalationspfade und Fristen fixiert.
- „No-Regret“-Maßnahmen priorisieren: Rezeptoptimierungen, die Spezifikationen nicht gefährden; präventive Wartung an Engpass-Anlagen; frühzeitige Kundenkommunikation mit realistischen Lieferfenstern.
- Konflikte moderieren: Aktives Zuhören, rekapitulierende Zusammenfassung, klare Ich-Botschaften. In Schichtübergaben wurden Updates ritualisiert und in leichter Sprache dokumentiert.
- Resultat:
- Die Liefertreue bei A-Kunden blieb über 95 %, Reklamationen nahmen nicht zu, die OEE stabilisierte sich nach zwei Wochen. Das Werk verabschiedete verbindliche „Rules of Engagement“ für künftige Engpasslagen, inkl. AAR-Prozess und KPI-Anpassungen. Wichtig: Das Vorgehen war transparent und auditfest; Entscheidungen ließen sich auch rückblickend begründen.
So wird Ihre Wirksamkeit greifbar: Sie zeigen, dass Sie Prinzipien vor Taktik stellen, Stakeholder zusammenführen, unter Unsicherheit strukturiert entscheiden und respektvoll kommunizieren. Genau das suchen Arbeitgeber – in der Schichtführung ebenso wie in internationalen Projektkontexten.
Take-away
Wenn starke Teams kollidieren, entscheidet Führung darüber, ob Konkurrenz entsteht oder eine Allianz, die das Gesamtsystem schützt. In Krisen bedeutet das: Werte voranstellen, Strukturen und Rollen klären, Entscheidungen unter Unsicherheit bewusst designen, Konflikte deeskalieren, KPIs systemisch ausrichten, über Ebenen und Kulturen klar kommunizieren und Resilienz sichern. Wer diese Mechanik beherrscht, macht Kooperation in Ausnahmesituationen rational – ganz gleich, ob es um kollidierende Welten im Film geht oder um hochkomplexe Produktionsrealität.
Sieben Hebel und Führungsleitplanken für Anlage und Leitwarte
Schichtbetrieb in der Chemieproduktion bedeutet Arbeiten unter wechselnden Bedingungen: geplante Start-ups, ungeplante Störungen, Produktwechsel, behördliche Audits, Lieferdruck und parallel hohe Sicherheitsanforderungen. Die zentrale Frage lautet: Wie bleiben Teams in Anlage und Leitwarte handlungsfähig, wenn die Lage dynamisch wird? Resiliente Teams zeichnen sich dadurch aus, dass sie Risiken antizipieren, klar kommunizieren, zügig lernen und Verantwortung teilen. Das lässt sich nicht allein durch „mehr Einsatz“ erreichen, sondern durch gezielte Führungspraktiken, Standards und Routinen, die Stabilität erzeugen – ohne Tempo und Flexibilität einzubüßen.
Im Folgenden finden Sie sieben praxisnahe Hebel, die sich in chemischer Produktion bewährt haben, sowie Leitplanken wertorientierter Führung, die Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein stärken. Das Ergebnis: weniger Fehler, sicherere Abläufe, schnellere Wiederanfahrten und spürbar mehr Engagement – besonders relevant für Schicht-, Betriebs- und Standortleiterinnen und -leiter.
Sieben Hebel aus der Produktion – konkret und umsetzbar
1) Klare Schicht-Start-Huddles mit Risiko-Fokus
Ein zielgerichteter Schichtbeginn schafft gemeinsame Lagebilder und Prioritäten. Statt langer Meetings bewähren sich 10–15-minütige Huddles mit fester Struktur:
- Sicherheit zuerst: Was sind die Top-3-Risiken der nächsten 12 Stunden (z. B. Start-up, Arbeiten mit Freischaltung, atypische Prozessfenster)? Welche Barrieren sind aktiv, welche temporär reduziert?
- Produktionslage: Engpässe, kritische Qualitäten, Energie-/Versorgungsstatus, geplante Arbeiten von Fremdfirmen.
- Ressourcen: Teamstärke, besondere Qualifikationen in der Schicht, verfügbare Unterstützung (z. B. Instandhaltung, Labor).
- Eskalationspfade: Wer ist ansprechbar, Schwellenwerte für Anruf/Stop/Management-Einbindung.
- Abschluss im Sinne von „Red Flags“: Woran erkennen wir, dass die Lage kippt?
Ein sichtbares Schichtboard (physisch oder digital) mit Risiken, Maßnahmen und Verantwortlichen macht die Huddle-Ergebnisse unmittelbar nutzbar. Entscheidend ist, dass Leitwarte und Feld gemeinsam sprechen – gleiche Informationen, gleiche Prioritäten.
2) 3-Wege-Kommunikation und SBAR für schnelle Eskalationen
Fehler in kritischen Situationen entstehen oft durch Missverständnisse. Zwei einfache Werkzeuge erhöhen die Qualität und Geschwindigkeit:
- 3-Wege-Kommunikation (Closed Loop): Sender gibt Auftrag, Empfänger wiederholt in eigenen Worten, Sender bestätigt oder korrigiert. Das kostet Sekunden, verhindert aber teure Abweichungen.
- SBAR-Struktur für Eskalationen: Situation – Background – Assessment – Recommendation. So gelingt fokussiertes Melden und Entscheiden, auch unter Zeitdruck. Beispiel: „S: Druck steigt im Reaktor R-12 über Soll. B: Seit 10 Minuten im Start-up, Heizer H-3 läuft auf 80 %. A: Trend stabil steigend, Relief-Ventil nähert sich Schwellwert. R: Heizer auf 60 % reduzieren, Ventilstellung prüfen, Schichtführer informieren.“
Schulen Sie die Teams kurz und praxisnah; visualisieren Sie SBAR neben den Telefonen in Leitwarte und Feld. Legen Sie klare Kriterien fest, wann SBAR-Eskalation verpflichtend ist (z. B. Sicherheitsrelevanz, Überschreiten von Prozessgrenzen, Ausfall redundanter Barrieren).
3) Robuste Schichthandover-Standards
Ein starker Übergang reduziert „blinde Flecken“ bei Abweichungen und Start-ups:
- Standardisierte Logbucheinträge mit Zeitbezug, Abweichungen, temporären Freigaben/Sperren, offenen Maßnahmen, Laborstatus, Energieversorgung.
- Gemeinsames Begehen/Übergeben kritischer Bereiche (Leitwarte-Feld-Duo), inklusive Sichtprüfung sicherheitsrelevanter Ausrüstung.
- 24-Stunden-Rückblick: Was war außerhalb der Norm? Welche Maßnahmen wirken noch nach in die kommende Schicht?
- Checkliste und Mindestzeitfenster (z. B. 20–30 Minuten überlappender Dienst), ergänzt durch kurze Nachbesprechung bei außergewöhnlichen Lagen. Einfach gilt vor perfekt: wenige, aber verbindliche Felder im Logbuch und eine visuelle Ampel für „kritische Punkte“ reichen oft, um die Qualität des Handover zu steigern.
4) Ermüdungsmanagement und Mikropausen
Ermüdung ist im Schichtbetrieb kein individuelles Versagen, sondern ein systemisches Risiko. Ein wirksamer Ansatz kombiniert Organisation und persönliche Strategien:
- Dienstplangestaltung: Limiten für aufeinanderfolgende Nachtschichten, ausreichende Ruhezeiten, planbare freie Tage.
- Mikropausen: 60–120 Sekunden „Augen-fokussieren/Schultern lösen/Atmen“ nach anspruchsvollen Tasks oder vor kritischen Eingriffen. In der Leitwarte helfen „Bildschirm-Entlastung“ und kurze Positionswechsel.
- Team-Rota bei Hochlast: In Stressphasen bewusst Aufgaben wechseln (z. B. einer beobachtet Trends, einer kommuniziert, einer dokumentiert), um kognitive Last zu verteilen.
- Bewusster Umgang mit Koffein, Flüssigkeit, Licht; klare Regeln für Überstunden und Nachforderungen. Machen Sie Ermüdung sichtbar: ein einfaches Fatigue-Risiko-Check (z. B. Skala 1–5 im Huddle) und die Option, Aufgaben temporär zu tauschen, senken das Fehler- und Unfallrisiko deutlich.
5) Psychologische Sicherheit mit klarer Stop-Work-Autorität
Resiliente Teams stoppen, bevor es kritisch wird – und zwar ohne Angst vor Schuldzuweisung. Das gelingt, wenn:
- Jede Person die Autorität hat, Arbeit zu unterbrechen, sobald Zweifel an Sicherheit oder Prozessstabilität bestehen. Die Regel: „Im Zweifel stoppen, Lage klären, sauber wieder anfahren.“
- Führungskräfte Stop-Entscheidungen sichtbar unterstützen und die saubere Wiederaufnahme priorisieren.
- „Speak-up“-Signale definiert sind (z. B. Codewort oder klare Formulierung), damit es in Stressmomenten kein Zögern gibt.
- Just Culture: Abweichungen werden systematisch analysiert – mit Fokus auf Bedingungen, Barrieren und Lernfelder, nicht auf individuelle Schuld. So entsteht die gewünschte Mischung aus Mut zur Unterbrechung und Disziplin bei der Wiederanfahrung.
6) Kurze After-Action-Reviews und Learning Teams nach Abweichungen
Schnelles Lernen ist die Versicherung gegen Wiederholfehler:
- 10–15-minütige After-Action-Reviews (AAR) unmittelbar nach Start-ups, Störungen oder Audits: Was war das Ziel? Was ist passiert? Was lief gut? Was ändern wir beim nächsten Mal?
- Vertiefte Learning-Teams bei größeren Abweichungen: interdisziplinär, mit Beteiligten und Betroffenen; Hypothesen testen, Bedingungen verstehen, Barrieren verbessern.
- Niedrige Hürde für Dokumentation: 1-Seiten-Format, Action-Items mit Verantwortlichen und Termin. Ergebnisse sichtbar machen (z. B. im Schichtboard) und in Standards überführen. Wichtig: Lernen schnell in Training, Checklisten und Handover überführen – sonst versandet es.
7) Skills-Matrix und Cross-Training
Teams sind widerstandsfähig, wenn sie flexibel reagieren können:
- Eine aktuelle Skills-Matrix zeigt für jede Rolle den Qualifikationsstand (z. B. Anfahren, Störungsdiagnose, Freischaltung, Produktwechsel, Audits).
- Cross-Training plant gezielt das Schließen von Lücken und reduziert Single-Point-of-Failure-Risiken.
- Kombination aus „on-the-job“-Mentoring und kurzen, fokussierten Lernmodulen (z. B. 20-Minuten-Mikrotrainings im Huddle) beschleunigt den Kompetenzaufbau.
- Rotationen zwischen Leitwarte und Feld stärken das gemeinsame Prozessverständnis. So entsteht Redundanz in Fähigkeiten – die beste Versicherung, wenn Ungeplantes passiert.
Leitplanken wertorientierter Führung: Vertrauen, Klarheit, Verantwortung
Standards und Tools wirken erst dann, wenn Führung eine Kultur der Verantwortung und des Vertrauens ermöglicht. Wesentliche Leitplanken:
- Klare Prinzipien statt Ad-hoc-Anweisungen: Definieren Sie wenige, nicht verhandelbare Grundsätze (Sicherheit vor Output, frühe Eskalation, saubere Wiederanfahrten vor „Heldentaten“). Verankern Sie sie im Alltag: in Huddles, AARs und Entscheidungsroutinen.
- Vorbildfunktion im Kleinen: Führungskräfte leben 3-Wege-Kommunikation, nutzen SBAR und fordern Mikropausen ein. Sichtbare Konsequenz erzeugt Nachahmung.
- Erwartungsmanagement: Rollen und Verantwortungen transparent machen – wer entscheidet was, wann und mit welchen Informationspflichten? Eskalationsschwellen schriftlich fixieren, zugänglich für alle.
- Verlässlichkeit und Fairness: Fehleranalysen ohne Schuldrituale, aber mit klarer Verantwortungsübernahme für Maßnahmen. Erfolge und saubere Stops aktiv anerkennen.
- Nähe zur Arbeit: Regelmäßige Präsenz am Ort der Wertschöpfung und in der Leitwarte, kurze „Go & See“-Runden mit echtem Interesse, nicht nur Kontrolle. Fragen wie: „Woran sehen Sie heute zuerst, dass etwas aus dem Ruder läuft?“ öffnen den Blick für Frühindikatoren.
- Invest in Kompetenzen: Zeit und Budget für Training schützen – auch unter Leistungsdruck. Ein Team, das gelernt hat, kann Druck in Leistung umwandeln, ohne Sicherheit zu kompromittieren.
- Sinn und Stolz: Vermitteln Sie, wie sichere, stabile Prozesse zu Produktqualität, Kundenvertrauen und Standorterfolg beitragen. Sinn stärkt Resilienz.
Wer diese Leitplanken konsequent lebt, setzt den Rahmen, in dem die sieben Hebel ihre volle Wirkung entfalten – nachhaltig und auditfest.
Umsetzung im Betrieb: pragmatisch starten, Wirkung messen, dranbleiben
Resilienz entsteht durch wiederholte, verlässliche Routinen. Starten Sie nicht „überall ein bisschen“, sondern fokussiert – mit messbaren Effekten:
- Pilotieren Sie zwei Hebel parallel, z. B. Schicht-Start-Huddle und 3-Wege/SBAR. Definieren Sie einfache Metriken: Anzahl/Qualität der Eskalationen, Zeit bis zur Stabilisierung nach Störereignissen, Abweichungsrate, Near-Miss-Meldungen, OEE-/Qualitätsstabilität.
- Standardarbeit dokumentieren: Huddle-Agenda, Handover-Checkliste, SBAR-Beispiele, AAR-Formular. Kurz, visuell, für alle zugänglich.
- Coaches/Mentoren benennen: Erfahrene Schichtmitglieder, die neue Routinen im Tagesgeschäft begleiten, Feedback geben und Korrekturen früh einbauen.
- Quick Wins sichtbar machen: „Vorher/Nachher“-Vergleiche von Wiederanfahrzeiten, Auditergebnissen oder Laborfreigaben schaffen Glaubwürdigkeit.
- Skalieren mit Augenmaß: Erst wenn die Grundroutinen stabil laufen, erweitern Sie um weitere Hebel (z. B. Skills-Matrix und Cross-Training). So bleibt die Veränderung beherrschbar.
- Regelmäßig reflektieren: Quartalsweise Review der Leitplanken und Metriken; Justierungen offen kommunizieren.
Mit diesem Vorgehen schaffen Sie robuste Abläufe, die auch unter Druck funktionieren. Teams in Anlage und Leitwarte behalten die Kontrolle, Entscheidungen werden schneller und sicherer, Start-ups laufen stabiler, Audits werden planbar. Die spürbare Folge: weniger Fehler, sicherere Abläufe, schnellere Wiederanfahrten – und mehr Engagement, weil Menschen mit klaren Prinzipien, guter Kommunikation und den passenden Fähigkeiten an den richtigen Aufgaben arbeiten. Genau dort entsteht Resilienz im Schichtbetrieb.
Leadership & Karriere in Chemie und Produktion – Blog von Dr. Michael Bessel
Praxisnahe Impulse und Tools für Studierende, Berufseinsteiger und Führungskräfte der Chemie/Verfahrenstechnik: strategische Karriereplanung, souveräne Kommunikation und Präsenz, strukturierte Argumentation und Präsentation, bewusste Körpersprache, Resilienz sowie wirksame Teamentwicklung. Insights aus 14+ Jahren Linien- und Standortverantwortung (Forschung, Expat, Projektführung), Bewerbungs- und Interviewtraining für den Berufseinstieg sowie Programme Werde ein Leader und Verantwortung übernehmen. Werteorientiert, individuell, international – mit Downloads, Beispielen aus der Praxis und aktuellen Kundenstimmen. Inhalte auf Deutsch und Englisch.
Beiträge nach Monat
2025
Von Schuldzuweisung zu Learning Teams: Resilienz, Sicherheit und Verfügbarkeit in Chemie und Produktion
Störungen, Beinahe‑Ereignisse und Veränderungen gehören in Chemie und Produktion zum Alltag: neue Rohstoffchargen, Wartungsfenster, Schichtwechsel, Anfahr‑ oder Abfahrprozesse, Turnarounds sowie internationale Projekt‑Schnittstellen. Entscheidend für Resilienz ist nicht die vollständige Vermeidung dieser Ereignisse, sondern wie Teams danach lernen. „Learning Teams“ und After‑Action‑Reviews (AAR) ersetzen Schuldzuweisung durch systematisches Lernen: Sie machen die gelebte Arbeit sichtbar, heben stille Erfolgsfaktoren und Hemmnisse, verankern Verbesserungen in MOC/PSM‑Prozessen und SOPs und stärken psychologische Sicherheit. Ergebnis: weniger Wiederholfehler, stabilere Prozesse, höhere Anlagenverfügbarkeit und mehr Vertrauen im Team.
Eine lernorientierte Teamkultur folgt drei Prinzipien:
- Menschen handeln rational in ihrem Kontext. Fehlentscheidungen sind meist Symptome von Zielkonflikten, Informationslücken oder Prozessdesign.
- Lernen entsteht aus offenen Fragen, nicht aus Rückblicken mit „Hätte, hätte …“.
- Erkenntnisse wirken erst, wenn sie in Standards, Kommunikation und Führungssysteme einfließen.
Im Folgenden erhalten Sie einen praxiserprobten Schritt‑für‑Schritt‑Leitfaden, ein Agenda‑Template mit Fragenkatalog, Moderationshinweise (inkl. SBAR‑Struktur), Regeln für respektvolle Sprache sowie Kennzahlen, die Fortschritt messbar machen – mit speziellen Hinweisen für Nachwuchsführungskräfte in internationalen/Expat‑Teams.
So laufen Learning Teams und After‑Action Reviews ohne Schuld ab
Rollen und Rahmen
- Moderator:in (neutral, prozesskundig, nicht hierarchisch dominierend) steuert Ablauf, Sprache und Zeittakt.
- Fachexpertise: Operator, Instandhaltung, Labor/QA, Prozessingenieur:in, EHS/PSM, ggf. Lieferant/Contractor; bei Schichtthemen bitte alle relevanten Schichten vertreten.
- Sponsor:in aus der Führung ebnet Ressourcen und schützt den „No‑Blame“-Rahmen.
- Timebox: kurz (30–45 Min.) für Mikro‑AAR nach Schicht; 60–90 Min. für Learning Team bei Ereignissen/Änderungen.
Moderationsleitfaden mit SBAR SBAR (Situation – Background – Assessment – Recommendation) schafft Klarheit, begrenzt Abschweifungen und senkt Hemmschwellen:
- Situation: Worum geht es konkret? Wann/wo trat das Ereignis auf? Welche Abweichung vom Soll?
- Background: Welche Bedingungen galten? Schichtlast, Anlagenzustand, SOP‑Version, Schnittstellen, Ziele/Drücke/Temperaturen.
- Assessment: Was hat funktioniert/nicht funktioniert? Welche Barrieren oder Zielkonflikte waren spürbar?
- Recommendation: Welche 1–3 umsetzbaren Maßnahmen (Prozess, Technik, Kommunikation) priorisieren wir?
Regeln für respektvolle Sprache
- System statt Schuld: „Welche Rahmenbedingungen begünstigten den Ablauf?“ statt „Wer hat…?“
- Beschreiben, nicht bewerten: Fakten, Beobachtungen und Wirkungen („Das Alarmfenster war 5 s, die Quittierung erfolgte im Störfeuer“) statt Absichten zu unterstellen.
- Ich‑ und Wir‑Botschaften nutzen; keine Etiketten („unaufmerksam“, „unkompetent“).
- Eine Person spricht, keine Unterbrechungen; Moderator:in paraphrasiert, fragt nach.
- Chatham‑House‑Regel: Inhalte werden geteilt, Zitate/Schuldzuweisungen bleiben im Raum.
- Daten schützen: personenbezogene Details nur, wenn sicherheitsrelevant, sonst anonymisieren.
- Übersetzungen/Begriffsklarheit: Abkürzungen erklären; bei internationalen Teams einfache Sprache.
Typische Fallstricke und wie Sie sie vermeiden
- Debatte über „Ideallösungen“ ohne Realität der gelebten Arbeit: Starten Sie bewusst mit „So machen wir es normalerweise…“.
- Aktionismus ohne Ursachenverständnis: Erst Muster erkennen, dann Maßnahmen.
- Maßnahmen ohne Eigentümer: Jede Maßnahme bekommt Owner, Fälligkeitsdatum, Erfolgskriterium.
- Lange Monologe: SBAR‑Karten im Raum/virtuell bereitstellen; Timekeeper benennen.
Praxisleitfaden: Agenda‑Template und Fragenkatalog
Agenda‑Template (60–90 Minuten)
- Check‑in (5 Min)
- Ziel und No‑Blame‑Rahmen bekräftigen; SBAR kurz erklären; Rollen klären.
- Ereignis klären – S/B (10–15 Min)
- Situation und Hintergrund in 1–2 SBAR‑Runden schildern; Faktenboard (Whiteboard/Miro) führen.
- Gelebte Arbeit sichtbar machen (15–20 Min)
- „So läuft es normal…“; „Was war diesmal anders?“; Barrieren, Zielkonflikte, Work‑as‑imagined vs. Work‑as‑done.
- Muster und Hebel identifizieren – A (15–20 Min)
- Was hat geholfen? Wo waren Frühwarnzeichen? Welche Kontrollen haben gegriffen/nicht gegriffen?
- Maßnahmen priorisieren – R (15–20 Min)
- 3–5 Maßnahmen SMART formulieren; Owner, Fälligkeit, Wirkindikator festlegen; Integration in MOC/PSM und SOP‑Pfad bestimmen.
- Kommunikation und Follow‑up planen (5–10 Min)
- Was geht in die Schichtübergabe, ins Daily/Shopfloor‑Board, in den Lessons‑Learned‑Kanal? Nächster Review‑Termin.
- Check‑out (5 Min)
- Was war heute hilfreich? Was verbessern wir am Format? Dank an Teilnehmende.
Fragenkatalog, der echte Erkenntnisse liefert
- Vor dem Ereignis
- Welche Aufgabe wollten Sie erfüllen? Welche Ziele standen im Vordergrund (Sicherheit, Qualität, Output, Zeit)?
- Wie sieht der „normale“ Weg aus? Wo weichen gelebte Routinen vom SOP ab – und warum?
- Welche Signale (Alarme, Töne, Vibrationen, Gerüche, Prozesswerte) galten als „normaler Lärm“?
- Während des Ereignisses/der Veränderung
- Was war anders als erwartet (Rohstoff, Wetter, Schichtbesetzung, Zeitdruck)?
- Welche Entscheidungspunkte gab es? Welche Informationen standen zur Verfügung/nicht zur Verfügung?
- Welche Kontrollen/Barrieren halfen? Welche irritierten oder wurden umgangen?
- Welche Zusammenarbeit war kritisch (Labor, Leitwarte, Feld, Instandhaltung, Contractor)?
- Nach dem Ereignis
- Was würden Sie wieder so machen? Was nie wieder – und was bräuchte es dafür?
- Welche SOP‑Passagen sind unklar, zu lang, zu komplex? Wo fehlen Bilder/Parameterfenster?
- Welche MOC‑Trigger sehen Sie (Equipment‑Change, Parametrierung, Software/Alarmmanagement, Personal/Schulung)?
- Welche kleinen, sofort machbaren Änderungen (2‑Tage‑Hebel) gibt es?
- Schicht‑ und Kulturfragen
- Wie stellen wir sicher, dass andere Schichten dieselben Hinweise bekommen?
- Welche Begriffe/Handzeichen sind missverständlich (auch in Englisch)?
- Wo erleben Sie psychologische Unsicherheit (Sprechhemmungen, Hierarchiebarrieren)?
Materialien und Hilfsmittel
- SBAR‑Karte A5 und Wandbild/Slide.
- Ereignis‑Canvas (Spalten: Situation, Hintergrund, Gelebte Arbeit, Muster, Maßnahmen).
- Action‑Log mit Feldern: Maßnahme, Owner, Fälligkeit, MOC/PSM‑Nr., SOP‑Abschnitt, Kommunikationskanal, Close‑Out‑Datum, Wirkindikator.
Kurz‑Formate für den Schichtalltag
- 10‑Min‑AAR nach Schicht: Drei Fragen „Was lief gut? Was überraschte? Was ändern wir morgen?“
- „Stop‑Think‑Talk“-Karten für Pre‑Job‑Briefings mit SBAR‑Mini.
- Digitale Good‑Catch‑Meldung am Handy (Bild + kurzer SBAR‑Text).
Vom Lernen zur Umsetzung: Integration in MOC/PSM, SOPs und Schichtkommunikation
Nahtstelle zu MOC/PSM
- Screening: Jede priorisierte Maßnahme erhält ein MOC‑Screening (Ja/Nein). Ja = formaler MOC mit Risikoanalyse (PHA/What‑if), Freigaben, Schulung, Wirksamkeitskontrolle. Nein = kleiner Change über lokales Kaizen/5S/Alarmtuning mit dokumentierter Begründung.
- Verlinkung: Action‑Log und MOC‑System verlinken (Nr., Owner). Maßnahmenstatus wöchentlich im Shopfloor‑Meeting.
- PSM‑Elemente nutzen: Management of Change, Operating Procedures, Training, Mechanical Integrity, Pre‑Startup Safety Review (PSSR), Incident Investigation, Emergency Planning, Compliance Audits.
SOP‑Updates
- Änderungen als Minimal‑Viable‑SOP: erst Quick‑Guide/One‑Point‑Lesson im Schichtordner/Tablet, dann vollständiges SOP‑Update.
- Visualisieren: Screenshots von HMI/Trendbildern, Parameterfenster, Fotos von Ventilen/Armaturen, Fehlerbilder.
- Versionierung: eindeutige Versionsnummer, Änderungsgrund, Datum, Schulungsnachweis je Schicht.
- Rückkopplung: 2–4 Wochen nach Update ein Mini‑Learning‑Team „Hat die Änderung gewirkt?“.
Schichtkommunikation
- Handover‑Template: SBAR‑Struktur in die Schichtübergabe integrieren (Top‑3 Risiken, Abweichungen, Maßnahmenstatus).
- Andon/Board: „Lessons Learned“-Spalte am Daily‑Board mit QR‑Link zum Kurzprotokoll.
- Lessons‑Learned‑Newsletter (monatlich): 3 Kacheln „Gesehen – Verstanden – Geändert“.
Kennzahlen, die Kultur und Wirksamkeit sichtbar machen
- Good Catches: Anzahl qualifizierter präventiver Meldungen pro 10.000 Arbeitsstunden oder pro 100 Schichten; Quote mit Feedback innerhalb 72 Stunden. Ziel: Anstieg und hohe Rückmeldequalität (keine Strafkultur).
- AAR‑Quote: Anteil relevanter Ereignisse/Änderungen, die innerhalb von 5 Arbeitstagen ein AAR/Learning Team durchlaufen haben. Ziel: >80%.
- Action‑Close‑Out: Anteil termingerecht geschlossener Maßnahmen; zusätzlich Median‑Durchlaufzeit (Tage) von Maßnahme bis Close‑Out. Ziel: >85% termingerecht, Trend zur Verkürzung.
- Wirkindikatoren: z. B. Wiederholungsrate ähnlicher Abweichungen, Alarmsättigung (Alarme/Std.), Zeit bis zur sicheren Stabilisierung nach An-/Abfahrten, First‑Pass‑Yield, ungeplante Stillstände.
- Beteiligung: Anzahl unterschiedlicher Rollen/Schichten pro Learning Team, Redeanteil (aus Notizen) als Proxy für psychologische Sicherheit.
- Qualität der Maßnahmen: Anteil systemischer Maßnahmen (Prozess/Technik/Trainingsdesign) vs. reiner Appelle an Aufmerksamkeit.
Hinweise zur Messung
- Keine „Quota“ erzwingen: Good‑Catch‑Ziele sollen ermutigen, nicht zu Scheinmeldungen führen.
- Visualisieren: einfache Heatmaps/Run‑Charts im Shopfloor‑Board.
- Review‑Ritual: Monatlicher 30‑Min‑Review der Kennzahlen mit Fokus „Welche zwei Hebel testen wir nächsten Monat?“.
Besonderheiten für Nachwuchsführungskräfte in internationalen/Expat‑Teams
Führen ohne Schuldzuweisung beginnt bei Ihnen. Als Nachwuchsführungskraft prägen Sie Sprache, Tempo und Konsequenz. In internationalen/Expat‑Settings kommen kulturelle und sprachliche Nuancen hinzu.
Praxis‑Tipps
- Vorbildfunktion: Starten Sie AARs mit einem eigenen Lernmoment („Ich habe gestern X übersehen…“). Das senkt Hemmschwellen.
- Klare Einladung: Formulieren Sie explizit, dass das Ziel Systeme zu verbessern ist, nicht Personen zu bewerten. Wiederholen Sie diese Botschaft in jeder Runde.
- Einfache, klare Sprache: Vermeiden Sie Idiome; nutzen Sie kurze Sätze. Zusammenfassungen doppelt (mündlich + visuell). Ermuntern Sie, in der Muttersprache zu erklären; übersetzen Sie die Essenz.
- Visual First: Nutzen Sie Bilder, Skizzen, Trends, P&IDs; markieren Sie Ventile/Loops farblich. Visuelles überbrückt Sprachbarrieren.
- Authority Gradient abbauen: Beginnen Sie mit den Stimmen aus dem Feld/der Leitwarte. Führung spricht zuletzt. Nutzen Sie „Round‑Robin“‑Beiträge.
- Zeit und Zeitzonen: Legen Sie Learning Teams so, dass alle Schichten/Zeitzonen rotierend teilnehmen können. Notfalls zwei kurze Sessions mit identischer Agenda und konsolidiertem Ergebnis.
- Rollen klären: Bei Contractors deutlich machen, dass offene Beiträge keine Vertragsnachteile haben; Vereinbarungen mit HSE/Site‑Management treffen.
- Training on the Job: Integrieren Sie Mini‑AARs in Pre‑Job‑Briefings und Schichtübergaben. Bauen Sie SBAR als Standard in SOP‑Anlagen ein (z. B. im Abschnitt „Abweichungen“).
- Anerkennung: Feiern Sie Good Catches sichtbar (z. B. monatlicher „Safety & Reliability Spot“). Wertschätzung verstärkt gewünschtes Verhalten.
- Nachhaltigkeit: Planen Sie den nächsten Review‑Termin und halten Sie ihn ein – Zuverlässigkeit der Führung ist der stärkste Kulturhebel.
Schritt‑für‑Schritt zum Start in Ihrem Bereich (erste 30 Tage)
- Woche 1: SBAR einführen, AAR‑Kurzformat testen, Good‑Catch‑Kanal vereinbaren.
- Woche 2: Erstes volles Learning Team moderieren; 3 Maßnahmen mit Ownern starten.
- Woche 3: MOC‑Schnittstelle etablieren; SOP‑Quick‑Guide als Pilot veröffentlichen.
- Woche 4: Kennzahlen sichtbar machen; Mini‑Review durchführen; Feedback zum Format einholen und anpassen.
Fazit für die Praxis Wenn Sie Learning Teams konsequent ohne Schuldzuweisung moderieren, Fragen nutzen, die gelebte Arbeit sichtbar machen, und Erkenntnisse verlässlich in MOC/PSM, SOPs und die Schichtkommunikation überführen, entsteht Resilienz: Ihr Team kann Abweichungen früher erkennen, Lösungen schneller testen und Standards robuster verankern. Das ist starke Führung in Chemie und Produktion – wirksam, wertebasiert und nachhaltig.
Führen, Wirken, Wachsen – Blog für Chemie & Produktion
Praxisnahes Know-how von Dr. Michael Bessel für Karriere und Leadership in Chemie und Verfahrenstechnik: strategische Laufbahnplanung, souveräne Kommunikation, überzeugend bewerben, Führungswerkzeuge jenseits der Gehaltserhöhung, Resilienz und wirksame Teamentwicklung – mit Einblicken aus internationaler Linien- und Standortverantwortung für Studierende, Young Professionals und Führungskräfte.
Nonverbale Wirkung in Chemie und Produktion: Kompetenz, Teamorientierung und Ownership vom Interview bis HAZOP und Stage-Gate
In Chemie und Verfahrenstechnik entscheidet Ihre Wirkung nicht nur im Jobinterview, sondern auch in HAZOP‑Sitzungen, Stage‑Gate‑Reviews, Behörden‑Terminen oder operativen Shopfloor‑Runden. Entscheider achten dabei auf drei Dimensionen: Kompetenz (verstehen Sie die Sache?), Teamorientierung (können Sie wirksam mit anderen?), Ownership (übernehmen Sie Verantwortung ohne Schuldzuweisungen). Nonverbale Kommunikation übersetzt diese drei Faktoren in wahrnehmbare Signale, lange bevor Ihr Inhalt greift.
- Kompetenz zeigen Sie durch ruhige, präzise Bewegungen und klare räumliche Struktur: Sie ordnen am Whiteboard, benutzen den Stift als Zeigestab statt als Taktstock, und lassen Diagramme für sich sprechen.
- Teamorientierung zeigen Sie, indem Sie Blickkontakt fair verteilen, aktiv zusehen und wertschätzend nicken, andere Namen nennen („wie Frau Yilmaz eben am Reaktor 2 beobachtet hat“) und kurze Anschlussfragen stellen.
- Ownership signalisieren Sie mit aufrechter, geerdeter Haltung, offener Brust, entspannten Schultern und klarer Sprache: „Ich übernehme die Maßnahme X und melde bis Freitag 12:00 Uhr zurück“ – getragen von ruhigem Ton, nicht von Lautstärke.
Diese Haltung wirkt in Interviews und Reviews identisch: Wer klar steht, ruhig atmet, strukturiert zeigt und Präsenz ohne Dominanz ausstrahlt, wird als professionell wahrgenommen – auch dann, wenn die Situation kritisch wird.
Praxis: Sitz‑ und Stehpräsenz, Einstiegsmomente, Panels und P&ID‑Erklärungen
Sitzpräsenz
- Setzen Sie sich leicht vor die Stuhllehne, beide Füße geerdet, Oberkörper aufrecht. Vermeiden Sie verschränkte Arme oder das Verhaken der Füße um die Stuhlbeine.
- Legen Sie Hände locker sichtbar auf Tisch oder Oberschenkel; die Handflächen dürfen gelegentlich offen nach oben zeigen.
- Atmen Sie einmal bewusst aus, bevor Sie sprechen. Das senkt die Sprechgeschwindigkeit und bringt Wärme in die Stimme.
Stehpräsenz (z. B. in HAZOP/Stage‑Gate)
- Hüftbreiter Stand, Gewicht gleichmäßig verteilt, Knie entspannt. Ihr Stand ist Ihr „Erdungspunkt“ in dynamischen Diskussionen.
- Schultern tief, Nacken lang. Kopfhaltung neutral – nicht nach vorne schieben.
- Bewegungen zielgerichtet: Ein Schritt zum Board, zeigen, ein Schritt zurück, Blick zur Gruppe. Keine Pendelwege.
Einstiegsmomente und Elevator Pitch
- Ihr erster Satz setzt den Ton. Nutzen Sie eine Dreiteilung: Kontext – Beitrag – Nutzen. Beispiel Interview: „Ich habe die letzten 18 Monate eine Entschäumer‑Strategie in der Vorpolymerisation mitentwickelt, übernehme aktuell die HAZOP‑Vorbereitung und fokussiere mich dabei auf Durchsatz und OTIF‑Stabilität. Ich zeige Ihnen kurz, wie wir Risiken priorisieren und wo ich konkret ansetzen würde.“
- Sprechen Sie langsamer als gewohnt, mit kurzem Blick über die Runde, bevor Sie in Details gehen. Ein ruhiger Start signalisiert Selbstkontrolle.
Umgang mit Panels
- Blickkontakt verteilen: Antworten Sie der Person, die fragt, und weiten Sie dann den Blick im Dreieck über die restliche Runde. So fühlen sich alle abgeholt.
- Benennen Sie Beiträge und binden Sie das Panel: „Herr Chen, Ihre Frage zu Spülgasen ergänzt die Beobachtung von Frau Bauer – lassen Sie mich beide Punkte am P&ID verbinden.“
- Sitzordnung nutzen: Wenn eine Seite dominiert, stellen Sie sich beim Erklären bewusst so, dass Sie beide Lager „über die Schulter“ ansprechen. Ihr Körper schafft Balance.
Whiteboard und P&ID/PFD souverän nutzen
- Struktur sichtbar machen: „Wir gehen von Feed über Reaktor 1 zum Stripper – drei Schritte.“ Zeichnen Sie erst Achsen/Blöcke, dann Flüsse, zuletzt Ausnahmen/Bypässe.
- Stift als Zeiger, nicht als Dirigentenstab. Zeigen, schweigen, schauen – dann sprechen. Die Pause lässt dem Publikum Zeit, den Fluss zu verarbeiten.
- Hände offen und ruhig: Vermeiden Sie schnelle Kreiselbewegungen. Offene Handflächen neben dem Schema signalisieren Transparenz und lädt zu Rückfragen ein.
- Platz am Board: Stehen Sie seitlich versetzt, damit das Diagramm frei bleibt. Drehen Sie sich beim Sprechen zum Publikum, nicht zur Wand.
Blickkontakt in Gruppen
- Arbeiten Sie mit dem 3‑Sekunden‑Takt: 2–3 Sekunden pro Person, dann weiter. Zu kurzer Blick wirkt flüchtig, zu langer fixierend.
- Auch stille Teilnehmende einbeziehen: Blicken Sie gezielt kurz zu ihnen, wenn Sie Zwischenstände zusammenfassen. Das stärkt die Teamorientierung.
- Bei virtuellen Hybrids: Erst in die Kamera, dann zu den Menschen im Raum, und zurück. So fühlen sich Remote‑Teilnehmende gleichwertig angesprochen.
Souverän auf kritische Fragen und Einwände reagieren
In Chemie‑ und Sicherheitsreviews sind kritische Rückfragen normal – sie sind Teil der Sicherheitskultur. Ihre nonverbale Antwort entscheidet, ob Sie als defensiv oder als lösungsorientiert wahrgenommen werden.
- Mikropause vor der Antwort: Ein kurzer Atemzug, Kinn leicht nach unten, Blick stabil. Das zeigt Selbststeuerung statt Reflex.
- Körperanker: Beide Füße fest, Schultern tief, Hände offen auf Tischhöhe. Vermeiden Sie Zeigegesten auf Personen; zeigen Sie auf Daten, Skizzen oder Maßnahmen.
- Paraphrasieren und strukturieren: „Wenn ich Sie richtig verstehe, geht es um die Temperaturspitze beim Start‑up. Es gibt drei Punkte…“ Zählen Sie mit ruhigen Fingergesten (1–2–3). Das ordnet die Situation.
- Ownership sichtbar machen: „Den Bias im Sensor nehme ich mit. Ich kläre Kalibrierhistorie und Redundanz bis Freitag und melde in der HAZOP‑Liste unter Knoten 3.2 zurück.“ Der klare Blick in die Runde untermauert die Zusage.
- Grenzen anerkennen: „Diesen Wert kann ich heute nicht belastbar verifizieren.“ Ruhiger Ton, offener Blick. Bieten Sie den nächsten sinnvollen Schritt an.
- Eskalation ohne Konfrontation: Bei emotionaler Zuspitzung einen Schritt zurück, beide Hände sichtbar, tiefer Atem. „Lassen Sie uns den Punkt parken und nach den Maßnahmen kurz separat abstimmen.“ Ihre körperliche Deeskalation schafft Raum.
Tipp bei Stress: Stellen Sie beide Füße bewusst auf, drücken Sie die Zehen kurz in den Boden und lösen wieder. Dieses minimal sichtbare Bodenkontakt‑Signal reduziert Adrenalin und stabilisiert die Stimme.
Online‑Settings: Kamera, Hände, stimmliche Wärme
Virtuelle Interviews und Reviews sind Standard. Kleine Anpassungen erhöhen Ihre Präsenz erheblich.
- Kamera auf Augenhöhe, leicht oberhalb der Blickachse. So vermeiden Sie den „Unterkanten‑Effekt“ und wirken wacher.
- Licht von vorne, Hintergrund ruhig. In technischen Gesprächen gern eine neutrale Fläche oder ein Whiteboard, keine ablenkenden Fensterlicht‑Kontraste.
- Bildausschnitt: Oberkörper bis knapp unterhalb der Brust, Hände sichtbar. Sprechen Sie mit gelegentlichen offenen Handbewegungen in Brusthöhe – das macht Inhalte greifbar.
- Blickführung: Beim Sprechen regelmäßig in die Kamera, beim Zuhören auf den Bildschirm. Kurze Kamera‑Blicke signalisieren Nähe, ohne unnatürlich zu wirken.
- Audio vor Video: Eine warme, tragfähige Stimme trägt mehr als perfekte Bildschärfe. Sprechen Sie tiefer ausatmen, betonen Sie Verben, machen Sie Mikropausen am Satzende.
- Digitales Whiteboard/P&ID: Cursor langsam führen, mit Hotkeys zoomen, Stop‑Momente setzen („Hier pause ich kurz“). Nutzen Sie farbliche Kontraste sparsam, maximal zwei Farben.
- Remote‑Panels einbinden: Nennen Sie Namen, bevor Sie eine Frage adressieren, und lassen Sie 2 Sekunden Latenz, ehe Sie weitersprechen. Ihre Geduld wirkt professionell.
International arbeiten: kulturelle Dos & Don’ts – und die 10‑Punkte‑Checkliste
Globale Teams bringen unterschiedliche Erwartungen an Raum, Blickkontakt und Turn‑Taking mit sich. Ohne in Stereotype zu verfallen, helfen einige universelle Leitplanken:
- Raum und Distanz: Halten Sie in Präsenzmeetings zunächst etwas mehr persönlichen Abstand und passen Sie sich der Gruppe an. Ihre offene Haltung kompensiert größere Distanzen.
- Begrüßung und Titel: In formellen Kontexten zu Beginn eher formell bleiben (korrekte Anrede, ggf. Titel). Wechseln Sie erst nach Einladung auf Vornamen.
- Blickkontakt: In vielen Kulturen gilt ein freundlicher, aber nicht starrer Blick als respektvoll. Vermeiden Sie Fixieren; schauen Sie beim Nachdenken kurz seitlich oder auf Ihre Notizen.
- Gestik: Offene, ruhige Bewegungen sind global anschlussfähig. Vermeiden Sie bildschirmfüllende Armbewegungen oder Fingerzeigen auf Personen.
- Turn‑Taking: In internationalen Calls bewusst Pausen setzen und andere namentlich einbinden. „Ms. Alvarez, would you like to add your view before we decide?“
- Karten/Unterlagen: Namen, Abkürzungen und Einheiten klar schreiben; P&IDs mit Legende starten. Zeigen Sie, dass Sie gemeinsame Referenzen ernst nehmen.
- Beobachten und anpassen: Schauen Sie, wie Senior‑Kolleginnen und ‑Kollegen im jeweiligen Standort nonverbal führen, und spiegeln Sie Tempo und Form der Interaktion – in einer höflichen, eigenen Version.
- Klärung erlauben: Wenn ein Signal unklar ist (z. B. Nicken als „ich höre zu“ vs. „ich stimme zu“), klären Sie freundlich: „Nur zur Sicherheit – stimmen wir dem Vorschlag zu, oder sammeln wir noch?“
Checkliste: 10 Signale, die Entscheider sofort als professionell wahrnehmen 1) Aufrechte, geerdete Haltung – im Sitzen wie im Stehen, Schultern entspannt, Kopf neutral. 2) Ruhiger Start – Atemzug, klarer erster Satz, langsamer als Alltagstempo. 3) Offene Hände – Handflächen sichtbar, keine Barrieren wie verschränkte Arme oder Laptopdeckel zwischen Ihnen und dem Gegenüber. 4) Gesteuerte Blickführung – 2–3‑Sekunden‑Blicke, faire Verteilung im Panel, bewusste Kamera‑Blicke online. 5) Struktur‑Gestik – Zählen mit drei ruhigen Fingern, klarer Wegweiser am P&ID, Schritt‑für‑Schritt‑Markierungen. 6) Aktives Zuhören – Nicken in kurzen Sequenzen, paraphrasierender Einstieg („Wenn ich Sie richtig verstehe…“), Notieren von Schlagworten. 7) Stimmliche Wärme – tiefer ausatmen, angenehme Lautstärke, klare Artikulation, kurze Pausen am Satzende. 8) Platzkompetenz – bewusstes Einnehmen von Raum am Board, seitlicher Stand statt Rücken zur Gruppe, Schritte mit Zweck. 9) Ownership‑Signale – klare Zusagen mit Zeitpunkt, ruhiger Blick in die Runde, kein Rechtfertigungs‑Ton. 10) Souveräner Abschluss – kurze Zusammenfassung, Next Step benennen, Dank an Beitragende („Danke für den Hinweis auf Knoten 3.2 – ich übernehme die Klärung“).
Wenn Sie diese Signale verlässlich abrufen, transportieren Sie in Interviews wie in HAZOP‑ und Stage‑Gate‑Reviews genau das, worauf Entscheider achten: sachliche Tiefe, Teamfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft – sichtbar, hörbar und glaubwürdig.
Führen, Wirken, Wachsen – Blog für Chemie & Produktion
Praxisnahes Know-how von Dr. Michael Bessel für Karriere und Leadership in Chemie und Verfahrenstechnik: strategische Laufbahnplanung, souveräne Kommunikation, überzeugend bewerben, Führungswerkzeuge jenseits der Gehaltserhöhung, Resilienz und wirksame Teamentwicklung – mit Einblicken aus internationaler Linien- und Standortverantwortung für Studierende, Young Professionals und Führungskräfte.
Vom Berufseinstieg zur Führungsverantwortung in 36 Monaten: Der 3‑Jahres‑Plan für Chemie und Produktion
Der Einstieg nach dem Studium ist kein Zufallstreffer – er ist das Ergebnis klarer Prioritäten. Wer seine Stärken und Werte systematisch in einen Plan übersetzt, beschleunigt die eigene Entwicklung und erhöht die Chance, früh Verantwortung zu übernehmen. Starten Sie mit drei Fragen:
- Was kann ich nachweislich gut? (z. B. analytisches Denken, ruhige Führung in Schichtumgebungen, saubere Versuchsdurchführung, strukturiertes Projektmanagement)
- Was ist mir unverhandelbar wichtig? (z. B. Sicherheit, Wirksamkeit, Teamspirit, Integrität, Kundennähe, Nachhaltigkeit)
- Wo will ich in drei Jahren stehen – fachlich, organisatorisch und persönlich? (z. B. Projektleitung CAPEX, Schichtführung, QA‑Teamlead, globaler Tech‑Service)
Leiten Sie daraus einen 3‑Jahres‑Plan ab, der drei Ebenen abdeckt: 1) Rollenpfad: von der Einstiegsposition zu einer erweiterten Verantwortung (z. B. Prozessingenieur:in → Linienverantwortung → stellv. Produktionsleitung). 2) Kompetenzpfad: welche Schlüsselkompetenzen bauen Sie pro Jahr messbar aus (EHS und Prozesssicherheit, Daten & Automatisierung, Lean/Six Sigma, souveräne Kommunikation & Präsenz). 3) Netzwerkpfad: welche Stakeholder kennen Ihre Leistung (Mentor:in, Produktionsleitung, EHS, Qualität, Instandhaltung, externe Partner).
Formulieren Sie konkrete Hypothesen für 6/18/36 Monate:
- 6 Monate: sicherer Betrieb in meiner Rolle, erste Quick‑Wins (z. B. Reduktion von Stillständen, Audit‑Findings geschlossen), vertraute Beziehungen im Team, Mentor:in etabliert.
- 18 Monate: Leitung eines bereichsübergreifenden Projekts mit messbarem Ergebnis (z. B. OEE +4 Prozentpunkte, Scrap −20 %, Energie −8 %), Green Belt initiiert/abgeschlossen, interne Sichtbarkeit (z. B. Präsentation im Werksforum).
- 36 Monate: Führungsverantwortung in Linie oder Projekt (Budget/Personal), eigenständige Vertretung Richtung Management/Kunde, EHS‑Exzellenz nachweislich gelebt.
Diese Planung ist kein starres Korsett, sondern eine lernende Roadmap: Sie überprüfen quartalsweise, was funktioniert, und justieren, statt zu „springen“. Entscheidend ist der rote Faden: Ergebnisse, die Sicherheit, Qualität, Durchsatz und Kundennutzen verbessern – und damit genau das adressieren, woran Entscheider:innen Leistung messen.
Stellenanzeigen entschlüsseln und Einstiegsrollen gezielt wählen
Stellenanzeigen sind mehr als Wunschlisten – sie verraten, welche Probleme das Unternehmen wirklich lösen will. Lesen Sie zwischen den Zeilen:
- Muss‑ vs. Kann‑Kriterien: Woran würde die Rolle scheitern, wenn Sie es nicht können? Das sind Ihre Prioritäten (z. B. Schichttauglichkeit, HAZOP‑Erfahrung, Kundenkontakt).
- Umfeldsignale: Schichtmodell, Anlagenkomplexität, Regulatorik (GMP/REACH/Seveso), Reisetätigkeit, Sprache – sie prägen Ihren Alltag und Ihr Lernprofil.
- Erfolgsindikatoren: Welche KPIs werden genannt (OEE, Yield, ppm, On‑Time‑Delivery, Audit‑Score)? Das sind die Messlatten Ihrer Wirkung.
- Stakeholder‑Landkarte: Mit wem arbeiten Sie? EHS, Instandhaltung, Planung, Vertrieb, Kunde – Ihre Kommunikationsaufgabe zeichnet sich ab.
Wählen Sie Einstiegsrollen mit Blick auf Ihren 3‑Jahres‑Pfad:
- Produktion/Operations: Ideal, wenn Sie früh Menschen und Anlagen führen wollen. Sie lernen Entscheidungsstärke unter Zeitdruck, Schichtpraxis, EHS aus erster Hand und die Sprache der Fertigung. Typische Pfade: Schichtingenieur:in → Schichtleitung → Produktionsleitung. Geeignet, wenn Sie Präsenz, Pragmatismus und Teamführung schätzen.
- Verfahrenstechnik/Anlagenplanung: Für Systemdenker:innen, die gern an der Schnittstelle von Chemie, Technik und Wirtschaft arbeiten. CAPEX, Debottlenecking, Scale‑up, HAZOP/LOPA, P&IDs, Contractor‑Steuerung. Pfade: Projektleitung, Engineering‑Management, Standortentwicklung. Wer internationale Projekte sucht und gerne strukturiert argumentiert, ist hier richtig.
- Qualität (QC/QA): Für Sorgfalt und Regelwerk‑Affinität. Sie sind Gatekeeper für Compliance und Kundenanforderungen, moderieren Abweichungen, Audit‑Vorbereitungen, Freigaben. Pfade: QA‑Leitung, Supplier Quality, ggf. QP in der Pharma. Stärken: nüchterne Kommunikation, Konfliktfestigkeit, detailgenaue Analytik.
- Technical Service: Kundennah, lösungsorientiert, oft global. Sie transferieren Labor/Fertigungswissen in Anwendung, begleiten Trials, übersetzen Kundenbedarf in Produktionssprache. Pfade: Produktmanagement, Vertrieb/Service‑Leitung. Stärken: Präsentation, Empathie, technische Kreativität.
Entscheidend ist die Anschlussfähigkeit: Passt die Rolle zu Ihren Werten – und baut sie die Kompetenzen, die Sie in drei Jahren für Führung benötigen? Prüfen Sie, ob die Anzeigen Hinweise auf Lernmöglichkeiten bieten (Mentoring, Trainings, Zertifikate, internationale Einsätze).
Schlüsselkompetenzen priorisieren: EHS, Daten, Lean, Präsenz
Führung in der Chemie/Produktion heißt: Sicherheit, Qualität und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen – und Menschen dafür gewinnen. Priorisieren Sie deshalb vier Kompetenzfelder:
- EHS & Prozesssicherheit Was zählt: Sicheres Arbeiten ist nicht verhandelbar. Verstehen Sie HAZOP/LOPA, MOC‑Prozesse, Permit‑to‑Work, Explosionsschutz, Lockout/Tagout, Notfallorganisation. Kennzahlen wie TRIR, Near Misses, Audit‑Findings sind Führungsindikatoren. Wie Sie aufbauen: Übernehmen Sie eine Rolle im Sicherheitszirkel, moderieren Sie Toolbox‑Talks, führen Sie eine Mini‑Gefährdungsbeurteilung durch, schließen Sie offene Maßnahmen nachverfolgbar. Dokumentieren Sie, wie Sie Risiko reduziert und Verhalten positiv beeinflusst haben.
- Daten & Automatisierung Was zählt: Entscheidungen aus Daten. Verstehen Sie DCS/MES‑Grundlagen, Historian (z. B. PI), Sensorik, einfache Datenanalysen (SPC, Trendanalysen), Basics in Python/Power BI/Excel‑PowerQuery, sowie Change‑Management in der Automatisierung. Wie Sie aufbauen: Starten Sie ein Daten‑Mini‑Projekt (z. B. Temperatur‑Drift, Batch‑Consistency), visualisieren Sie Abweichungen, setzen Sie Alarme sinnvoll, zeigen Sie den „so what“-Effekt (Ausschuss −15 %, Durchsatz +3 %). Lernen Sie, mit IT/OT zu sprechen.
- Lean/Six Sigma Was zählt: Stabilität vor Geschwindigkeit, dann Verschwendung raus. Methoden: 5S, Wertstromanalyse, TPM, SMED, DMAIC, FMEA, Control Plan. Ein Green Belt ist in vielen Werken der Standard für Nachwuchsführung. Wie Sie aufbauen: Führen Sie einen Kaizen‑Workshop, standardisieren Sie eine Rüstsequenz, etablieren Sie visuelles Management, sichern Sie die Verbesserungen per Control‑Chart. Wichtig: echte Baselines, klare Zielgrößen, harte Einsparnachweise.
- Souveräne Kommunikation & Präsenz Was zählt: Entscheidungen tragfähig machen – nach oben, zur Seite und zum Shopfloor. Strukturierte Argumentation (z. B. Pyramid Principle), klare Storylines, adressatengerechte Charts, kurze Mails mit Entscheidungsvorschlag, bewusste Körpersprache und ruhiges Auftreten in Audits, Turnarounds oder Eskalationen. Wie Sie aufbauen: Halten Sie eine 10‑Minuten‑Management‑Präsentation zu Ihrem Projekt, moderieren Sie eine Lessons‑Learned‑Runde, holen Sie Feedback zu Wirkung und Verhalten ein. Trainieren Sie, technische Inhalte emotional anschlussfähig zu machen, ohne an Präzision zu verlieren.
Diese Felder sind Ihr Multiplikator: Sie erhöhen Sicherheit, Qualität und Effizienz – und zeigen, dass Sie Führung als Verantwortung für Menschen und Ergebnisse verstehen.
12‑Monats‑Checkliste: vom Einstieg zum sichtbaren Impact
Die ersten 12 Monate legen das Fundament. Arbeiten Sie diese Checkliste konsequent ab:
- Mentor:in finden
- Identifizieren Sie 1–2 erfahrene Personen (z. B. Produktionsleiter:in, EHS‑Manager:in), die für Ihre Wunschrolle „stehen“.
- Vereinbaren Sie ein klares Mentoring‑Format: monatliches Sparring, Zielbild, Verfügbarkeiten, offenes Feedback.
- Ergänzen Sie bei Bedarf externes Mentoring/Coaching für neutrale Perspektiven und Interview‑Sparring.
- Sichtbare Projekte übernehmen
- Wählen Sie ein „Goldilocks“-Projekt: klein genug für 3–6 Monate, groß genug, um wahrgenommen zu werden (z. B. Reduzierung von Anfahrverlusten, SMED an kritischer Anlage, SPC‑Einführung für Schlüsselparameter, Audit‑Vorbereitung).
- Klären Sie Scope, KPIs, Stakeholder, Risiken. Vereinbaren Sie Checkpoints und berichten Sie strukturiert.
- Suchen Sie die Bühne: Shopfloor‑Boards, Bereichsmeetings, Werksforum – nicht zum Selbstdarstellen, sondern um Wirkung transparent zu machen.
- Messbare Erfolge dokumentieren
- Legen Sie Baselines fest und quantifizieren Sie Ergebnisse: OEE +5 Prozentpunkte, Yield +1,2 %, Scrap −30 %, ppm −40 %, Stillstand −12 h/Monat, Energie −8 %, Audit: 0 kritische Findings.
- Rechnen Sie, wo sinnvoll, in Euro um – und dokumentieren Sie Nachhaltigkeit (Control‑Mechanismen).
- Führen Sie ein Leistungsjournal mit STAR‑Strukturen (Situation, Task, Action, Result) und sammeln Sie Referenzen/Feedbacks (z. B. kurze E‑Mails nach erfolgreichen Meilensteinen).
- Bewerbungspaket zum Ticket ins Interview schärfen – aus Sicht von Entscheider:innen
- Lebenslauf: vorn Erfolge, dann Aufgaben. Jede Station mit 2–3 Outcome‑Bullets (Kennzahl, Maßnahme, Effekt). Weg mit generischen Floskeln.
- Anschreiben: Bezug auf die tatsächliche Problemstellung der Stelle. Formulieren Sie Ihren „Value Case“ in drei Sätzen: Problem – Ansatz – Ergebnisbeispiel.
- Portfolio/One‑Pager: Drei Fallstudien mit Grafiken (vorher/nachher, KPI‑Trend), kurz und geschäftsrelevant.
- Online‑Profil: konsistent, mit 4–6 Schlagwörtern, die zu Anzeigen passen (EHS, HAZOP, OEE, Green Belt, DCS/MES, Kundenschnittstelle).
- Referenzen: Personen, die Ihre Wirkung bestätigen können (idealerweise funktionsübergreifend).
- Was Entscheider:innen wirklich hören wollen:
- Sicherheit zuerst: Sie treffen keine Kompromisse bei EHS – und verbessern Systeme, statt sie zu umgehen.
- Verlässlichkeit und Lernagilität: Sie liefern zu, reflektieren und heben das Niveau des Teams.
- Geschäftsnutzen: Ihre Maßnahmen haben messbaren Effekt auf Qualität, Durchsatz, Kosten, Liefertreue.
- Team- und Stakeholder‑Fähigkeit: Sie können überzeugen, auch wenn’s unbequem wird – sachlich, respektvoll, resilient.
- Blick nach vorn: Sie denken Skalierung, Standardisierung und Transfer in andere Linien/Standorte mit.
- Interviewtraining und Präsenz
- Üben Sie Antworten mit Struktur (Pyramide/STAR) zu drei Kernstories: „Sicherheit vor Produktivität“, „Daten führen zur Entscheidung“, „Schwierige Stakeholder gewinnen“.
- Bereiten Sie 3–5 präzise Fragen vor, die Kompetenz zeigen (z. B. „Wie messen Sie operativen Erfolg – OEE, Yield, ppm?“, „Wie ist MOC im Werk verankert?“, „Welche Automatisierungstiefe/DCS‑Generation nutzen Sie?“).
- Trainieren Sie Körpersprache: aufrecht, ruhig, klare Stimme, präzise Pausen. Präsenz heißt: Sicherheit und Zugewandtheit ausstrahlen.
- Simulieren Sie Remote‑Interviews (Technikcheck, Blick in die Kamera, prägnante Folien).
Wenn Sie diesen Plan konsequent umsetzen, bauen Sie in einem Jahr ein Profil auf, das nicht nur fachlich überzeugt, sondern Führung antizipiert: sicherheitsbewusst, datenbasiert, lean‑orientiert und kommunikationsstark. Genau darauf setzen erfolgreiche Teams – und genau das suchen Entscheider:innen.
Möchten Sie dafür strukturiertes Sparring aus der Praxis der Chemie‑ und Produktionswelt, unterstützen wir Sie mit einem wertebasierten, maßgeschneiderten Mentoring – vom Bewerbungstraining für den Berufseinstieg bis zu den Programmen „Werde ein Leader“ und „Verantwortung übernehmen“. Im kostenfreien Erstgespräch klären wir Ihre Ziele, vermeiden typische Bewerbungsfehler und schärfen Ihren 3‑Jahres‑Pfad. Kontakt: info@young-professionals-coaching.de oder Tel. +49 (0)176 227 127 67.
Führen, Wirken, Wachsen – Blog für Chemie & Produktion
Praxisnahes Know-how von Dr. Michael Bessel für Karriere und Leadership in Chemie und Verfahrenstechnik: strategische Laufbahnplanung, souveräne Kommunikation, überzeugend bewerben, Führungswerkzeuge jenseits der Gehaltserhöhung, Resilienz und wirksame Teamentwicklung – mit Einblicken aus internationaler Linien- und Standortverantwortung für Studierende, Young Professionals und Führungskräfte.